Geschichte
Geschichte der Hamburger Asien- und Afrikawissenschaften
von Prof. Dr. Michael Friedrich
Das Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg stellt heute den größten universitären Verbund der Asien- und Afrikawissenschaften in Deutschland dar, der durch mehrere Forschungsinstitutionen in der Freien und Hansestadt ergänzt wird. Zwanzig Professuren vertreten die Fächer Japanologie, Koreanistik, Sinologie, Vietnamistik, Thaiistik, Austronesistik, Tibetologie, Indologie, Iranistik, Islamwissenschaft, Turkologie, Äthiopistik und Afrikanistik. Knapp 50 Lehrende betreuen 1400 Studierende in 14 Magisterstudiengängen, von denen mehr als zehn Prozent einen anderen als den deutschen Paß besitzen; bei den Doktoranden liegt der Anteil der Ausländer bei etwa 50 Prozent.
Für den Unterricht von 50 asiatischen und afrikanischen Sprachen stehen zwei Sprach- und Medienlabore zur Verfügung; die Bibliothek bietet Zugang zu 350.000 Bänden sowie Bild-, Ton- und Filmarchiven. Partnerschaften mit einem guten Dutzend asiatischer und afrikanischer Universitäten dienen der Pflege von Kooperationen und dem Austausch von Studierenden. Im Asien-Afrika-Institut wird zur Zeit an mehr als 100 Forschungsprojekten gearbeitet, von denen viele durch Drittmittel finanziert sind; die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert Langzeitprojekte sowie einen Sonderforschungsbereich. Mitglieder des Asien-Afrika-Institutes geben 27 Zeitschriften und wissenschaftliche Reihen heraus. Wissenschaftliche Preise, Akademiemitgliedschaften und nicht zuletzt die Einrichtung einer Stiftungsgastprofessur sind Zeichen der Wertschätzung durch die Fachwelt.
Zum Sommersemester 2002 sind fünf der sechs Abteilungen des Asien-Afrika-Institutes gegenüber vom Bahnhof Dammtor im Ostflügel des Hauptgebäudes zusammengezogen. Nach jahrzehntelanger Zerstreuung auf bis zu acht Standorte in Campusnähe sind damit die Hamburger Asien- und Afrikawissenschaften auf die Moorweide zurückgekehrt. Die Abteilung für Kultur und Geschichte Indiens und Tibets wird ins Hauptgebäude nachfolgen, sobald es die Verwaltung geräumt hat. Bei dem Zusammenzug handelte es sich freilich nicht allein um die räumliche Verlagerung von Menschen und Büchern, sondern zugleich um den Abschluß der Aufbauphase des Asien-Afrika-Institutes, das im Mai 2000 unter dem Dach des Fachbereichs Orientalistik der Universität Hamburg gegründet worden war. Anläßlich dieser Zäsur mag es sinnvoll sein, einen Blick auf die Hamburger Asien- und Afrikawissenschaften zu werfen.
Wann es mit der Orientalistik in der Freien und Hansestadt begann, weiß niemand so recht. Meist wird der Theologe Hermann Samuel Reimarus genannt, 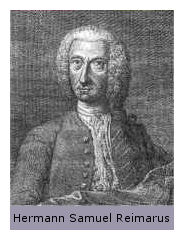 der 1727 Professor für orientalische Sprachen am Akademischen Gymnasium in Hamburg wurde. Wie viele seiner Zeitgenossen hatte sich auch Reimarus Gedanken über die chinesische Sprache gemacht, in der Tat also ein des Mythos würdiger Stammvater. Ganz so war es aber nicht: Die Professur für orientalische Sprachen gab es schon lange vor Reimarus an der 1613 gegründeten Lehranstalt, sie war dem Hebräischunterricht sowie der Bibelphilologie gewidmet und bestand bis zum Tode des letzten Orientalisten im Jahre 1882. Einer von dessen Schülern, der spätere Senior Georg Behrmann, lernte am Akademischen Gymnasium Arabisch und eignete sich später auch noch das Persische und das Türkische an. Er war es auch, der 1902 in Hamburg den 13. Internationalen Orientalistenkongreß ausrichtete und als Oberhaupt der hamburgischen Geistlichkeit die Herausgabe der Enzyklopädie des Islam förderte.
der 1727 Professor für orientalische Sprachen am Akademischen Gymnasium in Hamburg wurde. Wie viele seiner Zeitgenossen hatte sich auch Reimarus Gedanken über die chinesische Sprache gemacht, in der Tat also ein des Mythos würdiger Stammvater. Ganz so war es aber nicht: Die Professur für orientalische Sprachen gab es schon lange vor Reimarus an der 1613 gegründeten Lehranstalt, sie war dem Hebräischunterricht sowie der Bibelphilologie gewidmet und bestand bis zum Tode des letzten Orientalisten im Jahre 1882. Einer von dessen Schülern, der spätere Senior Georg Behrmann, lernte am Akademischen Gymnasium Arabisch und eignete sich später auch noch das Persische und das Türkische an. Er war es auch, der 1902 in Hamburg den 13. Internationalen Orientalistenkongreß ausrichtete und als Oberhaupt der hamburgischen Geistlichkeit die Herausgabe der Enzyklopädie des Islam förderte.
Schon lange vor Behrmann hatte es allerdings Überlegungen gegeben, in Hamburg eine Universität einzurichten, die den Besonderheiten der Hafenstadt Rechnung tragen sollte. 1828 sehen die Historiker Dahlmann und Niebuhr in einer künftigen Hamburger Universität den Vorzug "der frischen Weltluft, die in Hamburg geatmet wird"; 1847 erörtert der Syndikus Karl Sieveking in einer Denkschrift Ziele und Möglichkeiten einer "kosmopolitischen Universität". Hamburg besitze "vorzugsweise ein vermittelndes und weltbürgerliches Gepräge", das einer Begegnung der Nationen auch und schon unter den Studenten förderlich sei. Es geschah allerdings erst einmal nichts. Nach der Auflösung des Akademischen Gymnasiums 1883 betrieb Bürgermeister Kirchenpauer energisch den Ausbau der Wissenschaftlichen Anstalten, offenbar schon von der Absicht getragen, sie zum Grundstein einer späteren Universität zu machen. Werner von Melle setzte dieses Programm fort, ab 1891 als Syndicus, seit 1900 dann als Senator. Er widmete sich zunächst der Reform und dem Ausbau des Allgemeinen Vorlesungswesens, das als Relikt vom Akademischen Gymnasium geblieben war. Aufmerksam beobachtete er das auswärtige Universitätsleben und korrespondierte mit zahlreichen Gelehrten, um geeignete Männer für Hamburg ausfindig zu machen. Schon damals waren neben den "praktischen" Fächern Länder- und Völkerkunde vertreten, ebenso aber auch Geschichte und Sprachwissenschaften. 1905 wurde in Hamburg ein Schreiben des Harvard-Professors Hugo Münsterberg bekannt, in dem er eine "moderne Universität" empfahl, wo der notwendige "Zusammenhang mit dem Weltkreis zu suchen" sei.
Im Jahre 1907 ging es dann voran: Von Melle richtete mit Hilfe des Bankiers Max Warburg und eines Schulfreundes die wohldotierte Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung ein, und Edmund von Siemers stiftete ein Gebäude für das Allgemeine Vorlesungswesen auf der Moorweide, das heutige Hauptgebäude der Universität. Ausschlaggebend für die weitere Entwicklung war die Entscheidung der Budgetkommission des Reichstages, eine ordentliche Professur für Kolonialwissenschaften einzurichten. Als Standort war zunächst Berlin vorgesehen. In hektischen Verhandlungen gelang es Anfang 1908 dann, diesen Lehrstuhl nach Hamburg zu holen. Hamburg hatte nämlich inzwischen ein ganzes Kolonialinstitut angeboten, zu dem neben Lehrstühlen für Wirtschaft, Recht und Geographie auch eine Professur für Geschichte und Kultur des Orients gehörte. Am 20. Oktober 1908, also vor bald hundert Jahren, wurde das Kolonialinstitut feierlich eröffnet. Den orientalistischen Lehrstuhl hatte Carl Heinrich Becker übernommen. Das erste Vorlesungsverzeichnis listet neben Sprachkursen für Kisuaheli und Arabisch auch einen für Chinesisch auf, den Dr. Hagen, wissenschaftlicher Assistent am Museum für Völkerkunde, übernahm. Ferner las Becker im Rahmen des Allgemeinen Vorlesungswesens über "Die Hauptprobleme der modernen Orientpolitik" und "Islamkunde mit besonderer Berücksichtigung unserer Kolonien".
Die Hörer hatten damals eine Aufnahmegebühr von 20 Mark zu entrichten, pro Übung und Semester weitere 10 Mark, für halbsemestrige Veranstaltungen 5 Mark. Bedürftigen Personen konnten die Gebühren auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden; eines Antrags bedurfte auch die Ausstellung eines Zeugnisses. Im Gegensatz zu den manchmal sehr gut besuchten Veranstaltungen des Allgemeinen Vorlesungswesens saßen in denen des Kolonialinstituts nur wenige Hörer, meist vom Kolonialamt in Berlin abgeordnet. Ein Kaufmännischer Beirat sollte die Verbindung von Praxis und Wissenschaft sichern; die Kaufmannschaft hatte allerdings eine bloße Handelshochschule abgelehnt und sich ausdrücklich für eine wissenschaftliche Bildung ausgesprochen.
Nur wenige Wochen nach Eröffnung des Kolonialinstituts hatte von Melle weitere Professuren beantragt, darunter eine  für afrikanische oder, wie es damals hieß, Kolonialsprachen und eine für Ostasien. Beide waren ausdrücklich vom Kaufmännischen Beirat gewünscht worden. Der Sprachwissenschaftler und Afrikanist Carl Meinhof begann seine Tätigkeit bereits im folgenden Jahr, der Sinologe Otto Franke dann am 1. Januar 1910. Beide besetzten die ersten Lehrstühle ihrer Art in Deutschland; der afrikanistische war sogar der erste in der Welt. Nachdem Franke den Chinesischunterricht übernommen hatte, unterrichtete Hagen Japanisch für Anfänger. Herr Hara, ein "eingeborener" wissenschaftlicher Assistent am Museum für Kunst und Gewerbe, übernahm den Fortgeschrittenenkurs.
für afrikanische oder, wie es damals hieß, Kolonialsprachen und eine für Ostasien. Beide waren ausdrücklich vom Kaufmännischen Beirat gewünscht worden. Der Sprachwissenschaftler und Afrikanist Carl Meinhof begann seine Tätigkeit bereits im folgenden Jahr, der Sinologe Otto Franke dann am 1. Januar 1910. Beide besetzten die ersten Lehrstühle ihrer Art in Deutschland; der afrikanistische war sogar der erste in der Welt. Nachdem Franke den Chinesischunterricht übernommen hatte, unterrichtete Hagen Japanisch für Anfänger. Herr Hara, ein "eingeborener" wissenschaftlicher Assistent am Museum für Kunst und Gewerbe, übernahm den Fortgeschrittenenkurs.
Die Vorlesungen fanden in der Aula des Johanneums statt, Übungen wurden in dessen Hörsälen oder in Räumen von Museen abgehalten. Nach Fertigstellung des Gebäudes an der Moorweide zogen die in der Domstraße 8 beheimateten Seminare für Geschichte und Kultur des Orients sowie für Kolonialsprachen mit dem in der Dammthorstraße 25 untergebrachten Ostasiatischen Seminar dorthin um. Die Seminare bestanden aus zwei Räumen: Der Bibliothek, in der auch unterrichtet wurde, und dem Direktorenzimmer. Die Zahl der Studierenden blieb gering.
Die Gründung einer Universität stand weiterhin auf der Tagesordnung. In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg schlug ein Ausschuß der Bürgerschaft den Ausbau des Kolonialinstituts zu einer "Überseehochschule" vor, man dachte aber auch, bescheidener, daran, das Kolonialinstitut zur "Kolonialwissenschaftlichen Fakultät" einer Universität zu erweitern. Die Streitereien zwischen Universitätsfreunden und -gegnern sind hinlänglich dokumentiert, die Front verlief quer durch alle Lager. Betont werden muß allerdings, daß keineswegs alle Kaufleute gegen eine Universität waren, wie dies gern behauptet wird. Welchen Stellenwert das Thema für eine weitere Öffentlichkeit besaß, zeigt die Tagesordnung einer Bürgervereinsversammlung aus jenen Tagen: 1. "Errichtung eines Wartepavillons an der Endstation Zollvereinstraße", 2. "Verunreinigung der Straßen durch die Hunde", und 3. endlich "Errichtung einer Universität". Die Hamburger Nachrichten sahen wie viele andere in der Universität die Gefahr eines Massenbetriebes und sprachen bereits von einem "akademischen Proletariat". Alfred Lichtwark hingegen antwortete auf den Vorwurf, die Universität sei ein Luxus, mit dem vielzitierten Satz: "Der kostspieligste Luxus, den sich ein einzelner oder ein Staat leisten kann, sind Beschränktheit und Unwissenheit".
Ein in der Bürgerschaft gescheiterter Antrag vom 20. November 1912 führt unter § 1 bereits im zweiten Absatz aus: "die Universität [hat] die auf koloniale und überseeische Verhältnisse bezüglichen Wissenszweige besonders zu berücksichtigen". Otto Franke, der wesentlichen Anteil an der späteren Universitätsgründung hatte, hielt einem Gegner der orientalistischen Fächer entgegen, ihm fehle das Verständnis für den Versuch, "unserem Volke und seinen Führern den Blick zu schärfen für die weltpolitischen Entwicklungen der Gegenwart, Verständnis zu wecken für fremde Kultursysteme und fremde Eigenart". Stellungnahmen dieser Art sind nicht selten, so äußerte sich 1914 etwa Senator Heidmann: "Wenn man frage, warum wir Deutschen im Ausland am meisten gehaßt würden, [...] so sei es damit zu erklären, daß die deutschen [...] im Auslande ohne Verständnis für die Kultur des Auslandes seien und in Überhebung auf sie herabblicken". Gerade eine hamburgische Universität sei auch deshalb notwendig, damit "die hinausgehenden Deutschen sich mit der Kultur des betreffenden Landes beschäftigen".
 Der erste Weltkrieg machte zunächst einen Strich durch alle Pläne, kurz zuvor war es allerdings gelungen, weitere Professuren am Kolonialinstitut einzurichten. Die "Akademische Rundschau" vom März 1914 meldet, "daß je eine ständige Professur für Sprache und Kultur Japans [sowie] für Sprache und Kultur Indiens [...] geschaffen [...]" worden seien. Aus der Begründung wird zitiert: "Im Interesse der Erhaltung und Sicherung des Kolonialinstitutes muß [...] alles geschehen, was unter den gegenwärtigen Verhältnissen möglich ist, um Hamburg die bisherige führende Rolle auf dem neuen und eigenartigen Gebiete der kolonialen und überseeischen Wissenszweige zu wahren". Die "Rundschau" kommentiert: "Mit geschicktem Griff hat man hier [...] Stiefkinder der deutschen Wissenschaft hervorgeholt, um ihnen eine Arbeitsstätte zu bereiten. [...] Es ist in Hamburg selbstverständlich - gegenüber mancherlei betrüblichen Verhältnissen an preußischen Universitäten muß das hervorgehoben werden-, daß mit [den] Lehrstühlen ausreichend dotierte Seminare verbunden werden, die außerdem mindestens einen wissenschaftlichen Hilfsarbeiter und ein oder mehrere eingeborene Sprachgehilfen erhalten". Auch Hamburgs japanologische Professur war die erste in Deutschland.
Der erste Weltkrieg machte zunächst einen Strich durch alle Pläne, kurz zuvor war es allerdings gelungen, weitere Professuren am Kolonialinstitut einzurichten. Die "Akademische Rundschau" vom März 1914 meldet, "daß je eine ständige Professur für Sprache und Kultur Japans [sowie] für Sprache und Kultur Indiens [...] geschaffen [...]" worden seien. Aus der Begründung wird zitiert: "Im Interesse der Erhaltung und Sicherung des Kolonialinstitutes muß [...] alles geschehen, was unter den gegenwärtigen Verhältnissen möglich ist, um Hamburg die bisherige führende Rolle auf dem neuen und eigenartigen Gebiete der kolonialen und überseeischen Wissenszweige zu wahren". Die "Rundschau" kommentiert: "Mit geschicktem Griff hat man hier [...] Stiefkinder der deutschen Wissenschaft hervorgeholt, um ihnen eine Arbeitsstätte zu bereiten. [...] Es ist in Hamburg selbstverständlich - gegenüber mancherlei betrüblichen Verhältnissen an preußischen Universitäten muß das hervorgehoben werden-, daß mit [den] Lehrstühlen ausreichend dotierte Seminare verbunden werden, die außerdem mindestens einen wissenschaftlichen Hilfsarbeiter und ein oder mehrere eingeborene Sprachgehilfen erhalten". Auch Hamburgs japanologische Professur war die erste in Deutschland.
Noch während des Krieges, im Frühjahr 1917, wurden die Universitätsfreunde alarmiert, als Pläne verlauteten, das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, die Sprachschule für Kolonialbeamte, mit Reichsmitteln zu einer Auslandshochschule auszubauen. Die Pläne stammten vom ersten orientalistischen Professor des Kolonialinstitutes, Becker, der inzwischen Geheimrat im Preußischen Kultusministerium geworden war. Im Ergebnis wurde Anfang 1918 ein weiterer Ausbau des Kolonialinstitutes beantragt, der noch kurz vor Kriegsende die Unterstützung der Kaufmannschaft fand. Sie betonte, daß Universitätskosten nicht zu den toten, sondern zu den werbenden Ausgaben gehörten und daß die Universitätsfrage keine Finanzfrage sei.
Nach der Revolution im November 1918 überschlugen sich die Ereignisse: Im Januar begannen sog. Universitätskurse, die den Kriegsheimkehrern weiteren Zeitverlust ersparen sollten, und am 10. Mai 1919 wurde die Hamburgische Universität feierlich eröffnet. Bürgermeister von Melle sagte zu diesem Anlaß: "Die Beachtung des Auslands, und insbesondere der überseeischen Gebiete, und die Verfolgung der Länder und Völker verbindenden Gedanken, die in der Hamburger Wissenschaftspflege stets hervorgetreten sind und dann vor zehn Jahren durch die Errichtung unseres Kolonialinstitutes besonders stark und eigenartig zur Geltung gelangten, sie sollen in der Hamburgischen Universität fortgeführt und weiterentwickelt werden". Und das Hochschulgesetz von 1921 setzte die Akzente ähnlich: Die Universität habe "besonders für die Förderung der Auslands- und Kolonialkunde zu sorgen" (§ 4). Das Kolonialinstitut ging in der Philosophischen Fakultät auf; seine Zentralstelle, der Beschaffung und Sammlung von Informationen über Asien und Afrika oblag, wurde als Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv ausgegliedert.
Ein im Auftrag des Akademischen Senats erstelltes Portrait der Universität von 1927 würdigt die Wurzeln der jungen Universität, wenn es heißt: "Sie wahrt durch Betonung der Überseestudien selbständige Eigenart". Das Phonetische Laboratorium, das zunächst zur Afrikanistik gehört hatte, war inzwischen ein selbständiges Institut geworden; zur Islamkunde war eine Professur für Semitistik hinzugekommen, die 1964 auf Iranistik umgewidmet wurde. Meinhofs Afrikanisches Seminar erweiterte man um eine Südseeabteilung, aus der 1931 ein eigenständiges Seminar wurde. Es mag von Interesse sein, welche Sprachen dort unterrichtet wurden: Äthiopisch, Amharisch, Tigrina, Tigré, Somali, Galla, Berberisch, Hausa, Ful, Nama, Suaheli, Zulu, Herero, Mbundu, Bangala, Duala, Ewe und Vai, hinzu kamen neun Südseesprachen. Das war 1927, Jahre nach dem Ende des kolonialen Wahns. Heutzutage, im Zeitalter von "Globalisierung" und "Internationalisierung", reichen die Mittel gerade noch für acht oder neun afrikanische Sprachen. Zeitgenössische Berichte aus den Seminaren sprechen von engen Kontakten mit Kaufleuten und Bürgern, aber auch mit der internationalen Wissenschaft und mit den Bezugsregionen. Schon damals studierten auch junge Menschen aus Asien und Afrika hier. Im Jahre 1924 siedelte die Afrikanistik aufgrund von Platzmangel aus dem Hauptgebäude in die Rothenbaumchaussee um, 1927 zog auch das Orientalische Seminar aus.
Das Kolonialinstitut hatte zwar nicht, wie es sich von Melle erhofft hatte, zur Gründung der Universität geführt. Die Hamburgische Universität erkannte jedoch in dessen Erbe eine "selbständige Eigenart", die zu pflegen und fortzuentwickeln war. Wo gab es denn das in Deutschland: Sechs gut ausgestattete Seminare, die sich den Sprachen und Kulturen zweier Kontinente widmen! Drei Punkte scheinen auch heute noch bedenkenswert: 1. Hamburgs Selbstverständnis als weltoffene Hafenstadt war Voraussetzung für die Schaffung eines schon damals in Deutschland einzigartigen Verbunds von Asien- und Afrikawissenschaften; 2. die Forderung der Kaufmannschaft nach "wissenschaftlicher Bildung" anstelle von praktischer Ausbildung hat wesentlich hierzu beigetragen; 3. mehrfach spielte hierbei die Konkurrenz zwischen Hamburg und Berlin eine entscheidende Rolle, wobei die Freie und Hansestadt stets und durchaus zum eigenen Nutzen der Hauptstadt gegenüber ihre Vorrangstellung zu wahren wußte.
Im Jahre 1933 wurde aus der Hamburgischen die Hansische Universität. Auch Hamburger Orientalisten verstrickten sich in Schuld, wenngleich wohl in vielen Fällen eher aus politischer Naivität als aus Überzeugung. Ein Opfer ist namentlich bekannt: Der summa cum laude promovierten Arabistin Hedwig Klein  wurde 1938 vom Dekan Fritz Jäger, einem Sinologen, die Promotionsgenehmigung entzogen. Das Schiff, welches sie ins sichere Indien bringen sollte, rief man kurz vor Kriegsausbruch 1939 zurück. Hedwig Klein wurde 1942 mit dem ersten direkten Transport von Hamburg nach Auschwitz deportiert. Julian Obermann hatte man bereits 1933 als "Nichtarier" die Lehrbefugnis entzogen, er fand jedoch in den USA an der Yale-Universität eine neue Existenz. Neben dem bereits erwähnten Jäger hatte sich auch Wilhelm Gundert, ein Japanologe, exponiert, nicht nur durch explizit nationalsozialistische Äußerungen und Publikationen, sondern auch durch Übernahme politischer Ämter. So war er von 1938 bis 1941 zum Rektor ernannt worden, was 1945 zur Streichung des japanologischen Lehrstuhls führte. Von solchen Ausnahmen abgesehen, dürfte zutreffen, was eine Untersuchung der Verhältnisse in der Afrikanistik trotz zahlreicher Parteieintritte resümierend feststellt: "aus den publizierten wissenschaftlichen Arbeiten der Hamburger [läßt sich] kaum ein Einfluß dieser Ideologie feststellen, geschweige denn, daß von einer Nazi-Afrikanistik geredet werden könnte". Institutionell gewannen jedoch die Asien- und Asienwissenschaften an Bedeutung: 1933 wurden die ersten Auslandsdiplome vergeben, 1937 hielt man eine Afrika-Woche ab, vor dem Kriege gab es zudem einen Überseetag. 1938 wurde erneut auf höchste Veranlassung ein Kolonialinstitut gegründet, das allerdings eine Papierinstitution blieb und nach Stalingrad 1943 spurlos verschwand. Die Ausstattung der Seminare mit Personal und Sachmitteln verbesserte sich deutlich.
wurde 1938 vom Dekan Fritz Jäger, einem Sinologen, die Promotionsgenehmigung entzogen. Das Schiff, welches sie ins sichere Indien bringen sollte, rief man kurz vor Kriegsausbruch 1939 zurück. Hedwig Klein wurde 1942 mit dem ersten direkten Transport von Hamburg nach Auschwitz deportiert. Julian Obermann hatte man bereits 1933 als "Nichtarier" die Lehrbefugnis entzogen, er fand jedoch in den USA an der Yale-Universität eine neue Existenz. Neben dem bereits erwähnten Jäger hatte sich auch Wilhelm Gundert, ein Japanologe, exponiert, nicht nur durch explizit nationalsozialistische Äußerungen und Publikationen, sondern auch durch Übernahme politischer Ämter. So war er von 1938 bis 1941 zum Rektor ernannt worden, was 1945 zur Streichung des japanologischen Lehrstuhls führte. Von solchen Ausnahmen abgesehen, dürfte zutreffen, was eine Untersuchung der Verhältnisse in der Afrikanistik trotz zahlreicher Parteieintritte resümierend feststellt: "aus den publizierten wissenschaftlichen Arbeiten der Hamburger [läßt sich] kaum ein Einfluß dieser Ideologie feststellen, geschweige denn, daß von einer Nazi-Afrikanistik geredet werden könnte". Institutionell gewannen jedoch die Asien- und Asienwissenschaften an Bedeutung: 1933 wurden die ersten Auslandsdiplome vergeben, 1937 hielt man eine Afrika-Woche ab, vor dem Kriege gab es zudem einen Überseetag. 1938 wurde erneut auf höchste Veranlassung ein Kolonialinstitut gegründet, das allerdings eine Papierinstitution blieb und nach Stalingrad 1943 spurlos verschwand. Die Ausstattung der Seminare mit Personal und Sachmitteln verbesserte sich deutlich.
Nach 1945 findet sich kein Wort mehr von der "überseeischen" Eigenart der Universität. Obwohl das Universitätsgesetz von 1921 "gewohnheitsrechtlich wieder anwendbar" wurde, erwähnt die Verfassung der Universität als Eigenart nur noch die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen Anstalten. Und eine Vorstellung der Philosophischen Fakultät von 1955 fängt hausbacken mit der facultas artium an, zitiert dann deutsche Idealisten und führt, nach der Philosophie und den nicht näher spezifizierten philologisch-historischen Fächern noch Pädagogik, Psychologie und Soziologie an. Wolfgang Franke, 1978 emeritierter Sinologe, erinnerte sich kürzlich: "Für die Universitäten der Bundesrepublik [...] war auch noch in den 1950er Jahren Ostasien völlig belanglos. Selbst in Hamburg konnte ich erst 1956 erreichen, daß der 1945 abgeschaffte Lehrstuhl für Japanologie wiederbesetzt wurde. [...] In der Philosophischen Fakultät [...] galt verständlicherweise alles, was in der NS-Zeit geschehen war, als schlecht und abwegig. [...] Dieses oder jenes sei vor 1933 so oder so gewesen und müsse dementsprechend geregelt werden [...] So wirkte an den bundesdeutschen Universitäten die traditionelle eurozentrische Einstellung der Vergangenheit weiter". Gerade dem Einsatz von Franke junior war es allerdings zu verdanken, daß der Ausbau der orientalistischen Fächer voranschritt: 1966 kamen je ein zweites Ordinariat für Sinologie und Indologie hinzu, weitere Fächer und Sprachen wurden etabliert.
Im Jahre 1969 wurden die Fakultäten aufgelöst, aus ihnen entstanden 15 Fachbereiche, darunter auch der Fachbereich Orientalistik mit den Asien- und Afrikawissenschaften. Das neue Universitätsgesetz hatte die alte "Eigenart" ersatzlos gestrichen, und das Hamburgische Hochschulgesetz von 1978 verlangt nur noch in allgemeiner Form und von allen Hochschulen, "die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit" und "den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen" zu fördern (§ 3 Abs. 4); das heutige Leitbild der Universität Hamburg gibt sich ähnlich beliebig. Dieser erstaunlichen Horizontverengung stand glücklicherweise der langjährige Präsident Fischer-Appelt entgegen, der die Asien- und Afrikawissenschaften in Wort und Tat stets förderte. Ihm - und natürlich auch der klugen Politik der Fachvertreter - ist der zwar schwierige, aber doch kontinuierliche Ausbau zu verdanken. Der vorläufig letzte Schritt in diese Richtung war die Schaffung einer Professur für Koreanistik im Jahre 1992.
Seit Beginn der rigiden Mittelkürzungen in den folgenden Jahren wurden vier Professuren entweder gestrichen oder in "billigere" Stellen umgewandelt: Je eine für Japan und China, die dem Ausbau gegenwartsbezogener Schwerpunkte gewidmet waren; eine für Südafrika, das wirtschaftlich und politisch nach dem Ende der Apartheid zu einer regionalen Großmacht aufstieg, sowie diejenige für Altorientalistik. Dieses Fach ist ersatzlos weggefallen. Gestrichen wurden ferner etliche Stellen von wissenschaftlichen Mitarbeitern - auch dies im Zeitalter von "Globalisierung" und "Internationalisierung". Der Einsicht des amtierenden Präsidenten ist es zu verdanken, daß die Professur für Vietnamistik wiederbesetzt werden kann und das Damokles-Schwert über dem zweiten Indologie-Lehrstuhl zurückgezogen wurde. Kürzungen im Sachmittelhaushalt und der ungünstige Dollarkurs haben zu einem Kaufkraftverlust von bis zu 50% geführt - mit detrimentalen Folgen für die Bibliotheken und damit für Forschung und Lehre. Ohne das Engagement der Studierenden hätten in den letzten Jahren selbst während des Vorlesungsbetriebes die Bibliotheken nur an zwei Tagen in der Woche offen gehalten werden können.
Inzwischen haben sich aber auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände geändert: Die geltenden Studienordnungen der Asien- und Afrikawissenschaften stammen noch aus den siebziger Jahren, als es nur eine Handvoll Studierender gab. Inzwischen sind diese Fächer schon lange keine Orchideeen mehr, ganz im Gegenteil. Die Hörerschaft ist vor allem zahlreicher, aber auch heterogener geworden: Manche kommen erst nach mehrjähriger Berufspraxis an die Universität, die meisten müssen nebenher arbeiten, und viele erhoffen sich durch ein Studium der Asien- und Afrikawissenschaften bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Neue Organisationsformen der wissenschaftlichen Arbeit und veränderte Kriterien der Mittelvergabe verlangen interdisziplinäre Kooperationen und Projekte. Für die Asien- und Afrikawissenschaften gilt ferner, daß die meist auf die jungen Nationalstaaten bezogenen Fächergrenzen in historischer Perspektive nur bedingt taugen. Wollte man nicht tatenlos den neuen Entwicklungen zusehen, waren also Ideen mit Zukunftperspektive gefragt.
Nach mehrjährigen Beratungen, die durch Empfehlungen einer externen Gutachterkommission 1997 zusätzliches Gewicht gewannen, wurde von einer Initiative dann am 25. Mai 1998 der Antrag auf Errichtung eines gemeinsamen Institutes gestellt. Die Afrikanistik hatte zunächst gezögert, schloß sich aber bald danach an. In der Begründung des Antrags heißt es: Bei " Einschätzung der gegenwärtigen Lage [ergab sich], daß die an der Universität Hamburg vertretenen Asien/[Afrika]-Fächer im nationalen Rahmen noch einen vorzüglichen Rang einnehmen. Allerdings verfügen manche unserer Fächer an anderen deutschen Universitäten über entschieden größere Sach- und Personalmittel. Gleichwohl sind die HH-Fächer nach Ausweis einer Aufstellung des Bundesamtes für Statistik überproportional erfolgreich bei der Absolventenquote. Das gilt auch für die Herausgabe wissenschaftlicher Zeitschriften und Schriftenreihen, aber auch für die Verzahnung unserer Fächer mit dem öffentlichen Leben. Und der Verbund dieser Fächer ist im nationalen Rahmen in seiner Vielfalt und Geschlossenheit einzigartig.
Ein solches [...] Institut ist für zukunftsorientierte Einwirkungen auf die Gesellschaft der Bundesrepublik dringend erforderlich. Diese bedarf einer kontinuierlichen Erweiterung ihrer Perspektiven über das kleine Europa hinaus. Hierfür ist ein solches Institut naturgemäß ein gewichtigerer Bezugspunkt als das Konglomerat der bisherigen Einrichtungen [...]. Das gilt auch für die Entwicklung neuer Studiengänge und den Ausbau der internationalen wissenschaftlichen Kooperation sowie anderer Kooperationen.
Neben der effizienteren Verwendung von Sach- und Personalmitteln nannte der Antrag weitere Ziele, darunter: für die Schaffung neuer fach- und regionenübergreifender Lehreinheiten und Studiengänge, darunter auch Kurzstudiengänge; [...] für gemeinsame wissenschaftliche Projekte, die zur Einwerbung von Drittmitteln führen; [...] für eine Verbesserung der Darstellung der ganzen Universität Hamburg in den Bezugsregionen dieses Institutes."
Inzwischen war auch bekannt geworden, daß ein Mäzen ganz in der Tradition der eingangs erwähnten Namen dem Hauptgebäude zwei Flügelbauten gestiftet hatte, und daß im zweiten dieser Bauten die Asien- und Afrikawissenschaften nach mehr als 75 Jahren wieder ein gemeinsames Zuhause finden sollten. Die absehbare räumliche Zusammenführung der über den Campus verstreuten Seminare verlieh den inhaltlichen Argumenten des Antrags zusätzliches Gewicht. Im Frühjahr 2000 hatte er endlich alle universitären Instanzen passiert und wurde innerhalb weniger Wochen von der Behörde für Wissenschaft und Forschung mit Schreiben vom 26. Mai 2000 genehmigt.
Aus dem Fachbereich Orientalistik war durch diesen Verwaltungsakt das Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg mit den ehemals selbständigen Seminaren und Instituten als Abteilungen geworden. Schritte zur Neugliederung und Straffung der Verwaltung wurden eingeleitet und Vorbereitungen für die Integration der bisherigen Teilbibliotheken in ein Medienzentrum im Ostflügel getroffen, das an sechs Tagen in der Woche auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Eine einheitliche Studienordnung für alle am Asien-Afrika-Institut vertretenen Fächer befindet sich im Genehmigungsverfahren. Neben der Einführung von Kurzzeitstudiengängen sieht sie auch fachübergreifende Studiengänge vor. Nach dem Umzug wird sich das Asien-Afrika-Institut verstärkt an die Öffentlichkeit wenden, mit einer jährlichen Festveranstaltung und durch Ausstellungen und Veranstaltungen im Asien-Afrika-Forum, dem Foyer des Ostflügels.
Mit dem Zusammenzug von immerhin fünf der sechs Abteilungen wird die Aufbauphase des Asien-Afrika-Instituts weitgehend abgeschlossen sein. Die räumlichen Möglichkeiten des Ostflügels bieten bundesweit einmalige Voraussetzungen, um sein anspruchsvolle Programm zu verwirklichen. Zu diesem Zweck bedarf es allerdings nicht nur der Anstrengung seiner Mitglieder, sondern auch der politischen Einsicht, daß sinkende Personal- und Sachmittel bei steigenden Kosten die keineswegs unrealistischen Pläne zur Etablierung eines international konkurrenzfähigen Zentrums für Asien- und Afrikawissenschaften in der Substanz gefährden: Da Bildungsausgaben ihre volle Wirkung oft erst Jahre nach Investition entfalten, ist rasches Handeln erforderlich. In Berlin scheint man wieder einmal die Zeichen der Zeit erkannt zu haben: Dort plant man auf Anraten des Wissenschaftsrates ein Asien-Zentrum, welches die betreffenden Einrichtungen der beiden großen Universitäten umfassen soll. Und dort hat man mehrere neue Professuren geschaffen, darunter eine für Ostasiatische Kunstgeschichte und gleich zwei für die Koreanistik. Dort plant man aber auch einen noch weitergehenden Ausbau.
Es war ein langer Weg vom Kolonialinstitut über den Fachbereich Orientalistik bis hin zum Asien-Afrika-Institut. Wie es weitergeht, wird wesentlich von den Entscheidungen der kommenden Jahre abhängen. Die Hamburger Asien-Afrika-Wissenschaften lagen der Freien und Hansestadt einmal am Herzen. Werden sie also mit dem Umzug auch dorthin zurückkehren? Zu wünschen wäre es beiden, der Stadt und der Wissenschaft.
Quelle: Universität im Herzen der Stadt. Eine Festschrift für Dr. Hannelore und Prof. Dr. Helmut Greve. Herausgegeben von Jürgen Lüthje, Hamburg 2002, Seite 170-179.
