Meldungsarchiv bis 2017
Veranstaltungen 2017
30.06. bis 02.07.2017
Asien-Afrika-Institut, Raum 120
Tagung:
WAHRNEHMUNG PERFORMATIVITÄT EMOTIONALITÄT Dimensionen des Körpers im vormodernen Japan
Tagung des Arbeitskreises für Vormoderne japanische Literatur
Angestoßen durch theoretische Überlegungen in Philosophie und Anthropologie hat sich in den Literaturwissenschaften der letzten Jahrzehnte ein vielfältiges Interesse an der menschlichen Körperlichkeit entwickelt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Neuentdeckung und Neubewertung des Körpers, der durch das 20. Jahrhundert hindurch konzeptionalisiert wird als Bezugspunkt disparater Entwürfe. Diese Pluralität an Körperbegriffen wirkt hemmend und produktiv zugleich; nur selten ist die Rede etwa von “Körperstudien”. Dass die Be- und Einschreibung des menschlichen Körpers grundsätzlich ein kulturelles Verfahren ist, zeigen Analysen aus der neueren europäischen Literaturwissenschaft u.a. zu Prousts verkörperter Erinnerung im Madeleine-Motiv oder zur Körperlichkeit in Kafkas Apparat in der Strafkolonie. So überzeugend ein solcher Ansatz sein mag, bis dato sind nur wenige Versuche zu verzeichnen, die eine Öffnung des Gegenstandes in Richtung der vormodernen, geschweige denn der außereuropäischen Literatur unternehmen.
Bei dieser Tagung steht daher die Frage nach der Körperlichkeit, d.h. nach den Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Körpers in der vormodernen japanischen Literatur im Vordergrund. Es geht dabei nur in zweiter Linie um den Körper als Gegenstand des Narrativs (etwa als Motiv), obwohl dieser Punkt ebenfalls behandelt werden darf. Vielmehr soll gefragt werden, wie der Körper derartige Narrative ermöglicht, insofern Primärfunktionen wie Wahrnehmung, Emotionalität, Erfahrung, Erinnerung, Kommunikation etc. Körperlichkeit immer schon voraus setzen. Von besonderem Interesse ist dann, wie literarische Texte im weiteren Sinn diese Voraussetzung berücksichtigen oder gar als gestalterische Herausforderung thematisieren.
Die Tagung wird organisiert von
Eike Großmann, Steffen Döll und Jörg B. Quenzer
Bei Interesse an einer Teilnahme bitten wir um kurze Voranmeldung unter japanologie"AT"uni-hamburg.de
"Politischer Protest und gesellschaftliches Engagement in Japan"
Japans Bürgergesellschaft wird häufig als „unsichtbar“ betitelt. Einem hohen Grad an Engagement auf Graswurzelebene stehen dabei  nur wenige medienwirksame Protestaktionen gegenüber. Zahlreiche Japaner engagieren sich in Nachbarschaftsvereinigungen oder Verbanden, oft in enger Zusammenarbeit mit den Lokalregierungen. Wenige hingegen gehen den Schritt hinaus auf die Straße und machen ihrem Unmut über politische Entwicklungen öffentlich Luft. Woran liegt dies? Und wie wirksam ist Japans Bürgergesellschaft mit dieser Strategie der kleinen unsichtbaren Schritte? Was lässt sich in Deutschland lernen von Japans Verständnis um Protest und Engagement?
nur wenige medienwirksame Protestaktionen gegenüber. Zahlreiche Japaner engagieren sich in Nachbarschaftsvereinigungen oder Verbanden, oft in enger Zusammenarbeit mit den Lokalregierungen. Wenige hingegen gehen den Schritt hinaus auf die Straße und machen ihrem Unmut über politische Entwicklungen öffentlich Luft. Woran liegt dies? Und wie wirksam ist Japans Bürgergesellschaft mit dieser Strategie der kleinen unsichtbaren Schritte? Was lässt sich in Deutschland lernen von Japans Verständnis um Protest und Engagement?
In dieser Ringvorlesung werden aus einem multidisziplinaren Blickwinkel heraus Themen wie Umweltschutz, Krieg und Frieden, Migration, wachsende gesellschaftliche Differenzen oder auch Japans Bürgerverständnis angesprochen. Historische Perspektiven finden ebenso Berücksichtigung wie die Zeitwende der Fukushima-Katastrophe und die aktuellen Entwicklungen unter der Regierung von Shinzō Abe.
Vortragsreihe an der Universität Hamburg in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg
Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, Westflügel, Hörsaal 221, 20146 Hamburg
Einzeltermine zwischen April und Juli 2017, Beginn jeweils um 18.00 Uhr
30.05.2017, 18.00 Uhr
Von-Melle-Park 6, Hörsaal Phil C
不思議なクニの憲法 The Choice in Ours
Der Dokumentarfilm (2016) begleitet japanische Bürgerinnen und Bürger vor der Oberhauswahl im Sommer 2016. Thematisiert wird die Frage, was es bedeutet, wenn sich die Regierungskoalition von Shinzō Abe in dieser Wahl eine Zwei-Dr ittel-Mehrheit der Sitze im Oberhaus sichern kann und damit der Weg für eine Verfassungsreform eröffnet wird.
ittel-Mehrheit der Sitze im Oberhaus sichern kann und damit der Weg für eine Verfassungsreform eröffnet wird.
Der Film wird im japanischen Original mit englischen Untertiteln gezeigt.
Die Regisseurin Hisako Matsui wird anwesend sein und im Anschluss an die Vorführung für ein Gespräch mit dem Publikum zur Verfügung stehen.
http://fushigina.jp/
Montag, 22. Mai 2017, 18:00 Uhr
Asien-Afrika-Institut, Raum 121
Technikzukünfte und Robotik für das Alltagsleben in Japan: 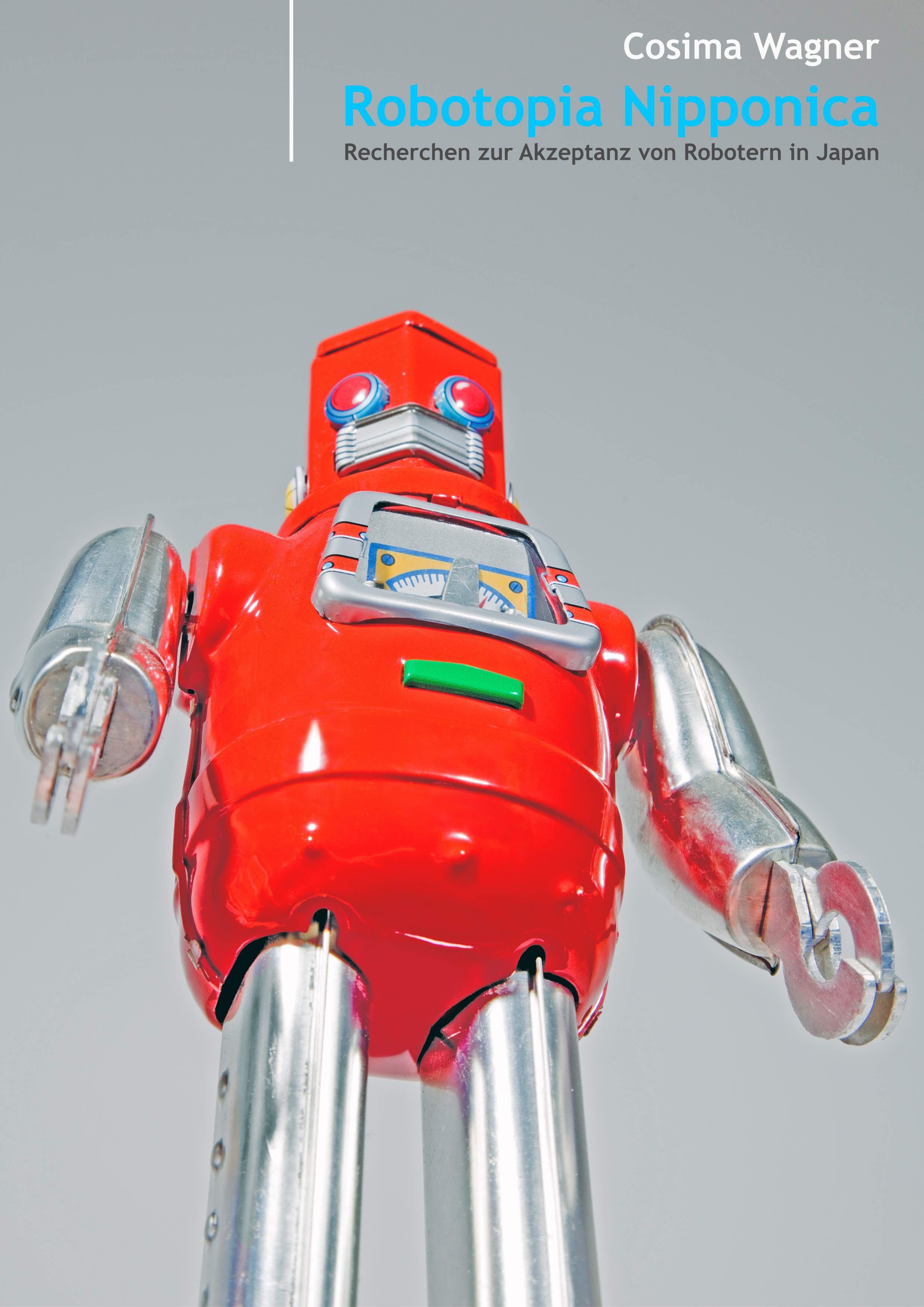
Aus der Perspektive der Technikstudien
Dr. Cosima Wagner
Freie Universität Berlin
Folgt man den Verlautbarungen der “Robot Revolution Realization”-Kampagne (Robotto kakumei jitsugen inishiatibu) der Regierung Abe seit dem Jahr 2014, sollen in naher Zukunft in sämtlichen Bereichen des Alltagslebens in Japan Roboter zum Einsatz kommen und das Land sich als “world’s most advanced robot showcase” bzw. “robot barrier free society” einen Namen machen. Eine uneingeschränkte Akzeptanz der Technologie durch alle NutzerInnen in Japan wird vorausgesetzt.
Im Vortrag wird diese Annahme aus der Perspektive der Science & Technology Studies (STS) / Technikstudien kritisch hinterfragt und die soziokulturelle Einbettung der Entwicklung sowie Nutzung von Servi-ce-Robotern in Japan analysiert: Welche Visionen der technischen Zukunft werden präsentiert und welche Roboter-Leitbilder adressiert? Welche Vorannahmen in Bezug auf die Entwicklung und Nutzung von Robotertechnologie liegen dem zugrunde? Welche Erfahrungen mit Roboter-Modellen im Alltag sind bereits dokumentiert? Welche kritischen Stimmen und Initiativen zur Einbeziehung von ethischen Fragestellungen sowie NutzerInnen-Interessen gibt es?
Mit dem methodischen Zugriff der Technikstudien sollen Faktoren der kulturellen Prägung von Technik in Japan aufgezeigt und die Fruchtbarkeit des Ansatzes für japanologische Forschung und Lehre erörtert werden.
Dr. Cosima Wagner studierte Japanologie und Geschichte in Marburg, Berlin und Kyôto. Ab 2003 forschte und lehrte sie an der Japanologie Frankfurt zu Technik in Japan, Alltags- und Konsumgeschichte Japans nach 1945 und zum Diskurs um den weltweiten Boom der japanischen Populärkultur. Promotion 2008. Seit 2016 ist sie als wissenschaftliche Fachreferentin im Bereich Forschungsdatenmanagement der FU Berlin tätig.
20.01.2017 18.00 Uhr und 21.01.2017 15.00 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221
Little Boy - Big Typhoon 少年口伝隊一九四五
von Hisashi Inoue 作 井上ひさし
Theateraufführung in japanischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Termine: 20.01.2017 18.00 Uhr und 21.01.2017 15.00 Uhr
Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut, Raum 221
Eintritt frei
Flyer zur Veranstaltung
Ausführende: Studierende der Abteilung für Sprache und Kultur Japans, Universität Hamburg
Traversflöte: Marika Oyama
Beleuchtung: Sachiko Tajima-Zimmermann
Bilder: Goro Shikoku
Regie: Sachiko Hara (Deutsches Schauspielhaus Hamburg)
Projektleitung: Saki Sugihara
Zum Werk:
Nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima versuchen drei überlebende Jungen, die Hoffnung nicht aufzugeben, und übermitteln mündlich die Nachrichten der Lokalzeitung in der zerstörten Stadt. In diesem Werk werden mittels einer fiktiven Geschichte viele historische Ereignisse im Zusammenhang mit dem Atombombenabwurf 1945 und dessen Folgen dargestellt. Das Drama appelliert an die nachfolgenden Generationen, das Geschehene nicht zu vergessen.
Zum Autor:
Hisashi Inoue (1934–2010) gehört zu den bedeutendsten Dramatikern und Schriftstellern der japanischen Gegenwartsliteratur.
In seinen Werken stellt er politische und gesellschaftliche Themen sprachlich-literarisch anspruchsvoll und zugleich humorvoll dar.
Das Projekt wird gefördert vom Innovationsfonds Studium und Lehre der Fakultät für Geisteswissenschaft.
Mittwoch, 18. Januar 2017, 12 Uhr
Asien-Afrika-Institut, Raum 122
›Erinnerung und Selbstdarstellung. Autobiographisches Schreiben im Japan des 17. Jahrhunderts‹
mit Prof. Dr. Wolfgang Schamoni
Universität Heidelberg
Das eigene Leben nachzuvollziehen, die eigene Vergangenheit zu beschreiben und zu reflektieren, hat in der japanischen Literatur- und Geistesgeschichte eine lange Tradition, ohne dabei auf ein festes Genre beschränkt zu sein. Trotz dieser Popularität fehlte bislang der Versuch, die Elemente dieser Tradition systematisch zu erschließen und durch Übersetzungen auch für interdisziplinäre Fragestellungen, etwa der Geschichtswissenschaft, zu öffnen.
Mit seinem langjährigen Projekt, anhand einer Übertragung und detaillierten Kommentierung sämtlicher für ein Jahrhundert zugänglicher autobiographischer Texte dieses Desiderat beheben, hat Wolfgang Schamoni daher bahnbrechendes geleistet. Seine Analyse legt zudem den Schwerpunkt auf die sozialen Funktionen der Texte und ihre Überlieferungsformen. Hierbei gilt sein besonderes Augenmerk der Zugehörigkeit der Texte zu verschiedenen Textsorten der Zeit, die jeweils verschiedene formale und inhaltliche Konventionen implizieren. In diesem Werkstattgespräch wird er uns Beispiele aus seiner Arbeit vorstellen und sowohl Fragen der Übersetzung als auch der schwierigen historischen Kontextualisierung diskutieren.
Prof. Dr. Wolfgang Schamoni vertrat von 1985 bis 2006 die Professur für Japanologie mit dem Schwerpunkt „Moderne japanische Literatur“ an der Universität Heidelberg. Seine Arbeiten sind u.a. davon geprägt, dem Bezug von Literatur zur Lebenswirklichkeit in Japan nachzugehen. Zudem hat er eine Vielzahl von literarischen Werken ins Deutsche übertragen.
Veranstaltungen 2016
22.11.2016, 18:15 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, West, Raum 120
Welfare Regime and Migration
Wako Asato, Kyoto University
This presentation will discuss how welfare regimes intertwine with migration regimes in the process of rapid economic development and demographic change in Asian countries. One of the features of the Asian economic miracle was not only utilizing the demographic dividend and high educational attainment of its labor force, but also accepting migrants, domestic workers in particular, to facilitate the participation of local women in the labor market. From the social policy side, liberal familialism in Asian countries justified maintenance of “family value” and the commercialization and externalization of reproductive work by recruiting foreign domestic workers as extra family members. Sometimes this familialism triggered cross border marriage for the formation of family welfare, and this became the foundation of multiculturalism in some societies. In the process of demographic ageing, some Asian countries also borrowed institutional frameworks of welfare states in Europe such as Korea, Japan, and Taiwan. Therefore, divergence of welfare regimes of Asian countries is observed.
Wako Asato is an associate professor in the Graduate School of Letters / Asian Studies Unit of Kyoto University. He conducts extensive research on demographic change and care. This includes research on domestic workers, care workers, and nurses as well as their entanglement in the welfare regime. He also conducts an exchange program regarding care skills among Asian countries. He is an awardee of the Presidential Award of the Philippines in 2014.
18.07.2016, 18:15 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221
Shanghai Nightscapes: A Historical Sociology of Urban Chinese Leisure
James Farrer, Sophia University / Tokyo
Since Orville Schell's 1988 book Discos and Democracy urban nightlife has been identified as one of the visible markers of social change in China. Nightlife is a space in which class, gender, sexual, and other more subcultural identities are publicly performed. The urban nightscape is also a space of global flows, in which imported ideologies, images, sounds, tastes, and people are enjoyed and localized by Chinese people, especially youth. The talk will focus on the changes in the popular culture of dancing - from the 1920s to the present - showing how dance clubs have served as spaces for new forms of gendered sociability. In particular, the talk will focus on how dance clubs since the 1980s have transformed from mass leisure spaces into stages for conspicuous consumption and social distinction. This talk is based on the book Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City written by James Farrer and Andrew David Field (University of Chicago Press 2015).
James Farrer is Professor of Sociology and Global Studies at Sophia University in Tokyo, specializing in urban studies in East Asia, including research on expatriate communities, nightlife, sexuality, and food cultures. His publications include Opening Up: Youth Sex Culture and Market Reform in Shanghai, Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City (with Andrew Field), and Globalization and Asian Cuisines: Transnational Networks and Contact Zones (editor).
16.06.2016, 18:15 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221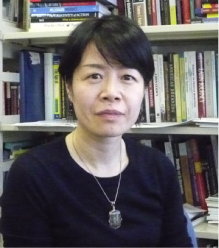
Immigrant Japan
Gracia Liu-Farrer, Waseda University / Tokyo
It is hard to imagine Japan, a society with a strong national cultural identity and a myth of racial homogeneity, as an immigrant society. Yet, by June 2015, there were 2,172,892 medium- to long-term foreign residents legally living in Japan. Half of them were permanent residents. In addition, hundreds of thousands of foreign nationals have obtained Japanese citizenship since the mid-1980s. Although at 1.7% of the total population, the presence of immigrants is not comparable to that in most other industrial countries, immigrants have nonetheless penetrated every aspect of economic and social life in this island country and are taking part in shaping its future. Based on many years of field research among immigrant families from different national backgrounds living in Japan, this presentation examines how immigrants make home, build communities, and understand their existence in a country with distinct patterns of social organization and powerful ethno-national cultural narratives. It also discusses how globalization has brought challenges to the concepts such as "immigration", "settlement" and "home" in a world where mobilities have become increasingly easy and belonging increasingly complex.
Gracia Liu-Farrer is professor of sociology at the Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Japan, and leads the Migration and Citizenship Research Group at Waseda Institute of Asia-Pacific Studies. Her research examines immigrants' economic, social and political practices in Japan, as well as Chinese immigrant children's identities and belongings in different destination societies. Her interests also include the global mobility of international students and wealthy Chinese. Her current research project is a sociological investigation of both immigrant and Japanese employees' experiences of globalizing Japanese firms. She has authored the monograph Labor Migration from China to Japan: International Students, Transnational Migrants (Routledge) and many book chapters and journal articles, most recently "Migration as Class-based Consumption: the Emigration of the Rich in Contemporary China" (China Quarterly, 2016).
23.05.2016, 12-13 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221
Berufsperspektiven für Japanolog_innen: JET - Japan Exchange and Teaching Programme
Sven Traschweski (Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin)
Das seit 1987 bestehende japanische Austausch- und Unterrichtsprogramm JET (Japan Exchange and Teaching Programme) zielt darauf ab, das gegenseitige Verstehen zwischen Japan und anderen Ländern zu fördern. JET kennt drei Programmlinien: die Intensivierung des Fremdsprachenunterrichts in Japan (ALT), die Förderung des internationalen Austauschs auf lokaler Ebene (CIR) und im Sport (SEA). JET bietet jungen Hochschulabsolventen die Möglichkeit, in regionalen Regierungsbehörden und staatlichen oder privaten Schulen zu arbeiten.
Sven Traschewski, zwischen 2006 und 2010 als CIR in Sapporo auf Hokkaido tätig, berichtet von seinen Erfahrungen im JET-Programm. Direkt nach dem Studium (Magister) der Japanologie und Sinologie in Erlangen/Nürnberg, Mie und der VR China wurde er für das JET-Programm ausgewählt. Inzwischen arbeitet er am Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB) im Projektmanagement und organisiert dort auch das German-Japanese Young Leaders Forum.
15.04.2016, 18:30
Edmund-Siemers-Allee 1, Hautpgebäude, Hörsaal J

Little Voices from Fukushima
Filmvorführung, Flyer
Little Voices from Fukushima is a documentary film dedicated to Japanese mothers and children living in the post-meltdown world of the Fukushima Daiichi nuclear power plant disaster. In the course of telling their stories, Director Hitomi Kamanaka takes us to Belarus, where we learn from mothers who experienced the Chernobyl nuclear disaster 28 years ago.
Hitomi KAMANAKA is a Japanese documentary filmmaker and media activist who has been working on nuclear power and radiation issues for two decades. She studied at the National Film Board of Canada and then worked as a media activist at Paper Tiger in New York. After returning to Japan, she directed many TV documentaries.
31.03.2016, 18:30
Edmund-Siemers-Allee 1, Hautpgebäude, Hörsaal J
Tell the Prime Minister
Filmvorführung und Gespräch mit dem Regisseur
After "Occupy Wall Street" in New York, and before the "Umbrella Revolution" in Hong Kong, 200 thousand people surrounded the Prime Minister's office in Tokyo for an anti-nuclear demonstration. However, this incident was not reported extensively by the media and subsequently went unnoticed by the world. This documentary film captures the anti-nuclear protests in Tokyo after the Fukushima nuclear incident in March 2011. The theme of the film is the crisis that democracy faces, and the reconstruction of democracy.
Eiji OGUMA is a professor of Faculty of Policy Management at Keio University in Tokyo. His research covers the national identity and nationalism, colonial policy, democracy thoughts and social movements in modern Japan from the view of historical sociology. This is his first film work, which was completed by cooperation of many activists and voluntary filmers.

24. 02. 2016, 18:30 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, Raum 221
Die Welt der japanischen katari-Rezitation: Vortrag mit Vorführung
HIRANO Keiko und weitere Mitwirkende
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Japanischen Generalkonsulat Hamburg u.a. Gefördert von THE JAPAN FOUNDATION
Die mündliche Überlieferung von Geschichten (katari) hat in Japan eine lange Tradition. Seit alters werden Sagen, Mythen und Legenden, Volksmärchen und Epen auf diese Weise vermittelt. Die katari-Rezitation ist daher ein wichtiges Element der japanischen Kultur, das andere traditionelle Künste Japans beeinflusst und inspiriert hat. Dabei trägt der Erzähler (kataribe) die Werke auswendig vor und fesselt das Publikum durch seine individuelle Interpretation. HIRANO Keiko ist eine bekannte Persönlichkeit in Japan. Sie war viele Jahre als Nachrichtensprecherin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender NHK tätig, tritt häufig als Erzählerin im Fernsehen und Theater auf und hat dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten.
Auf dem Programm stehen beispielsweise Auszüge aus dem ältesten japanischen Märchen Taketori monogatari (Die Geschichte vom Bambussammler), aus dem Makura no sôshi (Kopfkissenbuch) der Hofdame Sei Shōnagon, und dem Kumo no ito (Der Faden der Spinne) von AKUTAGAWA Ryūnosuke.
Begrenztes Platzangebot. Kartenreservierung ausschließlich schriftlich per E-Mail an hh-konsulat@bo.mofa.go.jp.
29.01.2016, 13-15:10Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120
The 5th Japanese Text and Japanese Language Education Workshop
The Graduate School of Humanities, Kobe University
Through a project funded by JSPS Graduate School of Humanities, Kobe University sends young researchers to Hamburg University to conduct joint studies on Japanese language and culture education. In the context of these studies we would like to invite you to a workshop where we will propose introducing literary works and a textbook based on JF Standard, "Marugoto" into Japanese language education.
28.01.2016, 16 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel West, 221
もののけ姫再考ー歴史学の観点から
(in japanischer Sprache)
Prof. Dr. Tetsu Ichizawa
Universität Kobe
1997年に公開された宮崎駿の映画『もののけ姫』は、日本映画の興行記録を塗り替える大ヒット作であった。しかし、この映画が当時の日本史研究の成果を 積極的に活用していることは、一般的には知られていない。また、大ヒットした反面、「背景がわかりにくい映画」という批評もある。そこで講演 では以下の2 点について考えたい。第一に、この映画が歴史学の成果をどのように活用しているかを明らかにすること。第二に、この映画の舞台を歴史学の成果と方法を 使っ て復元すること。この二つの考察を通じて、『もののけ姫』の作品としての奥行きを明らかにするとともに、宮崎が映画を作る行為、観る行為をどのようなもの としてとらえているかを考えたい。
"Princess Mononoke", the work of Miyazaki Hayao released in 1997, continues to be a great hit whose popularity endures even today. Nevertheless, the fact that this anime actively uses the results of Japanese history conducted to that day, is actually not well-known. Moreover, although it became a blockbuster hit, on the other hand it brought about criticism, being considered an anime with a difficult to understand background. And so, in my lecture, I will consider the following two aspects. The first one is to clarify the way in which this anime makes use of the results of historical science. Thesecond one is to restore its setting by using the methods and the research results of historical science. By considering these two aspects, I will clarify the depth of the work "Princess Mononoke" and I will consider the way in which Miyazaki captures the act of creating the anime and that of watching it.
Tetsu Ichizawa 市澤哲 is Professor at the Graduate School of Humanities and Faculty of Letters, Kobe University. His area of expertise is Japanese medieval history. His research interest is mainly in the political history of Kamakura and Muromachi period, but recently he is doing research on the representation of history in mass-media.
12.01.2016, 14 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120
Politik, nein danke?! Junge Japaner und politisches Engagement
Dr. Phoebe Stella Holdgrün
Deutsches Institut für Japanstudien, DIJ Tokyo
Phoebe Stella Holdgrün, Japanologin und Politikwissenschaftlerin, seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut fuür Japanstudien (DIJ) und seit 2015 ebendort stellvertretende Direktorin.
Ihre Dissertationsschrift ist 2013 unter dem Titel Gender equality. Implementierungsstrategien in japanischen Präfekturen bei iudicium erschienen. Zu ihren aktuellsten Veröffentlichungen zählt (gemeinsam mit Barbara Holthus): "Mothers Against Radiation: Issues of Gender and Advocacy", In: Mullins, Mark und Koichi Nakano (Hg.) (2016): Disasters and Social Crisis in Contemporary Japan: Political, Religious, and Sociocultural Responses. Palgrave Macmillan, S. 238-266.
Veranstaltungen 2015
14.12.2015, 14 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120
Leaning Out For The Long Span - What Holds Women Back From Promotion in Japan?
Prof. Glenda S. Roberts, PhD
Waseda University, Tokyo
Glenda S. Roberts is a socio-cultural anthropologist specializing in gender, work, family, and migration. She is Professor at the Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University. Among her most recent publications are, co-edited with Satsuki Kawano and Susan Long, Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty (University of Hawaii Press, 2014), and "Salary Women and Family Well-Being in Urban Japan," in Marriage & Family Review, 47: 571-589.
24.11.2015, 14 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 120
Perspektiven der japanischen Energiepolitik im internationalen Vergleich
Prof. em. Dr. Paul Kevenhörster
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Ausgewählte Publikationen:
Japan. Wirtschaft - Gesellschaft - Politik (mit Werner Pascha und Karen Shire), Wiesbaden: VS Verlag, 2010 (2. Aufl.).
Japans umfassende Sicherheit (mit Dirk Nabers), Hamburg: Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, 2003 (Nr. 364).
Japans Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand: Wegmarkierungen und Weichenstellungen, in: Chiavacci, David und Iris Wieczorek (Hg.): Japan 2008. Poltitik, Wirtschaft und Gesellschaft, Berlin: Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Japanforschung, 2008, S. 125-140 (Zum freien Download).
Prof. em. Dr. Paul Kevenhörster lehrt Politikwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seine Schwerpunkte sind Internationale Entwicklungspolitik und Ostasien.
29.10.2015, 18 Uhr c.t.
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221
Two Painterly Requiems for the Nuclear Disasters Over the Pacific, 1945-1954*
Prof. em. Dr. Shimizu Yoshiaki (Princeton University)
21.07.2015, 16:30-18 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221
Neue Diversitäten in Japan: Immigrantinnen auf dem Arbeitsmarkt
David Chiavacci
Japan wird in der Fachliteratur zu den neuen Immigrationsländern gezählt. Seit den späten 1980er Jahren verzeichnet es signifikante Immigrationsströme, wodurch sich im letzten Vierteljahrhundert die Anzahl der ausländischen Einwohner mehr als verdoppelt hat. Laut Statistik machen zwar Frauen mit 54,3% die Mehrheit unter den neuen Zu- und Einwanderern in Japan aus, jedoch sind bisher Genderperspektiven in der Migrationsforschung zu Japan selten und meist nur bzgl. bestimmter Gruppen wie Heiratsmigrantinnen oder Entertainerinnen berücksichtigt worden.
Im Fokus des Vortrages stehen Arbeitsimmigrantinnen in Japan; die Mechanismen und Strukturen in der Migration sowie ihre Position auf dem japanischen Arbeitsmarkt werden diskutiert. Zudem werden gegenwärtige und mögliche zukünftige Entwicklungen im Kontext der „Womenomics“ von Premierminister Abe erörtert. Die Analyse ergibt eine ausgeprägte Diversität unter den Arbeitsimmigrantinnen, wobei vier Hauptgruppen identifiziert werden können: (1) Hochqualifizierte; (2) nikkeijin; (3) Praktikantinnen; (4) Entertainerinnen. Nicht nur führen die Immigrantinnen zu einer ethnischen Diversifizierung Japans, sondern auch unter den Hauptgruppen sind starke Differenzen im Migrationsprozess und in der Stellung im Arbeitsmarkt auffällig.
David Chiavacci ist Mercator-Professor für sozialwissenschaftliche Japanologie an der Universität Zürich. Zu seinen Forschungsthemen zählen Migration und soziale Ungleichheit in Japan. Er ist Mitherausgeber des Japan-Jahrbuchs (mit I. Wieczorek, iudicium Verlag). Zu seinen neuesten Publikationen zählen: Ein neues Japan? Sozialer und politischer Wandel seit den 1990er Jahren (Asiatische Studien, Études Asiatiques, 67(2), 2013, Mit-hrsg. mit V. Blechinger-Talcott und C. Brumann); Japans neue Immigrationspolitik. Ostasiatisches Umfeld, ideelle Diversität und institutionelle Fragmentierung (2011, VS Verlag für Sozialwissenschaften).

07.07.2015, 18-20 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221
Hate Speech and Xenophobia in Contemporary Japan: Reflections on the Radical Right Group Zaitokukai
Takashi Kibe
In recent Japanese society, hate speech and xenophobic movements have surfaced. At the heart of them stands the radical right group Zaitokukai—the abbreviation for Zainichi Tokken o Yurusanai Shimin no Kai (Association of Citizens against the Special Privileges of the Zainichi). This group, which heavily draws on Internet-based mobilization, attacks particularly Korean residents, saying that they are enjoying unduly their “privileges” and undermining Japanese society. Scholars and public commentators have just started to research this phenomenon. What is the aim of this group? Who belongs to it? What are the social and political backgrounds that have caused it to emerge? Is a legislature against hate speech appropriate to effectively curb it? What harm to Japanese society does it present?
Placing the phenomenon of the Zaitokukai in a broader political context, I will argue that what is at stake here is not just a matter of hate speech. Japanese conservative politics and public policies related to foreign residents provide the group with grounds for its xenophobic discourse. They center on historical revisionism, heightened security issues with neighboring countries, and nativism in the welfare state. Considering this background, we are in a position to reply to the questions about the efficacy of legislating against hate speech as well as the social harm of the Zaitokukai.
Takashi Kibe is a professor of political science at International Christian University (ICU) in Tokyo. He has been working on empirical and normative issues of multiculturalism, migration, political secularism, and egalitarianism. Among his recent publications are Byōdo no Seijiriron [Political Theory of Equality] (Fukosha, 2015), “Can Tabunkakyosei Be a Public Philosophy of Integration?” in R. Drifte, W. Vosse, and V. Blechinger-Talcott (eds.), Governing Insecurity in Japan (Routledge, 2014), and “Tabunka no kyōzon [Multicultural Co-Existence],” in O. Kawasaki (ed.), Iwanami Koza Seijitetsugaku, vol. 6 (Iwanami, 2014).
30.06.2015, 18-20 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 123
Dezentralisierung in Japan
Momoyo Hüstebeck
Über Jahrzehnte galt der Zentralismus des japanischen Staates als effektives Instrument der Ministerialbürokratie, um mittels zweckgebundener Finanzmittel auch in strukturschwachen ländlichen Regionen die Modernisierung und den Wohlstand zu fördern und damit – wie in der Verfassung verbrieft – landesweit gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen. Angesichts der seit mehr als zwei Jahrzehnten andauernden wirtschaftlichen und politischen Krise wird der Zentralismus inzwischen als obsolet erachtet. Eine breite politische Allianz trug in den 1990er Jahren die Forderungen nach grundlegenden Staatsreformen. Die administrative Dezentralisierung (Devolution) und eine fiskalische Strukturreform, die seit 2000 nationale Aufgaben und Finanzen an die Präfekturen und Kommunen übertrugen, sollten den Grundpfeiler für eine substanzielle Neugestaltung des zentralistischen Staatssystems bilden.
Der Vortrag stellt die Ergebnisse der Dezentralisierungsreformen anhand zweier empirischer kommunaler Fallstudien in den Städten Mitaka und Fujimi vor. Dabei findet besonders der Zuwachs an politischer Autonomie und Bürgerpartizipation in beiden Städten Berücksichtigung.
Momoyo Hüstebeck leitet an der IN-EAST School of Advanced Studies der Universität Duisburg-Essen eine Nachwuchs-forschungsgruppe zu politischen Innovationen in ostasiatischen Städten. Zuvor war sie Postdoktorandin im Internationalen Graduierten Kolleg „Formwandel der Bürgergesellschaft. Japan-Deutschland im Vergleich“ der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. 2011 wurde sie mit einer Arbeit zur Dezentralisierung in Japan am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen promoviert.
10.06.2015, 12:15-13:45 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude, Hörsaal K
Integrierende Kräfte an Schulen in Japan – Studien zum inklusiven Schulalltag
Dipl.-Päd. Sabine Meise (Flensburg)
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung durch Japan im Jahre 2014 ist ein klares Signal für die Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft gesetzt. Eine wichtige Säule bildet dabei die Veränderung der Schule, die seit 2007 mit dem Beginn der „Speziellen Unterstützungserziehung“ (tokubetsu shien kyôiku 特別支援教育) neue Wege des Umgangs mit Unterschieden von Schülern geht und Diversität in Schulklassen verstärkt thematisiert. Der Vortrag gibt umfangreiche Einblicke in den japanischen Schulalltag (mit vielen Videos aus Hospitationen an Grund-, Mittel- und Oberschulen) und ermöglicht so, die aktuellen Herausforderungen, denen sich Japan im Bereich Bildung und Erziehung gegenübersieht, besser zu verstehen.
Mit dieser differenzierten Sicht auf den pädagogischen Alltag lässt sich das durch deutsche Medien erzeugte negative Image japanischer Schulen als „Drillanstalten“ kritisch hinterfragen. So erscheinen sowohl die Tatsache, dass in Japan eines der gerechtesten Bildungssysteme der Welt entstand, in dem weniger als 1% der Schüler mit „Unterstützungsbedarf“ (tokubetsu shien 特別支援) an Sonderschulen segregiert lernen, als auch die hervorragenden Resultate, die japanische Schüler bei internationalen Vergleichsstudien (PISA; TIMSS usw.) erzielen, in neuem Licht. Japan beweist, dass überdurchschnittliche Leistungen und Integration / Inklusion keinen Widerspruch darstellen, sondern einander bedingen. Sabine Meise ist Dipl.-Rehabilitationspädagogin und Grundschullehrerin. Seit 1988, davon zehn Jahre in Japan, arbeitet sie als Lehrerin und Wissenschaftlerin an verschiedenen Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Sie war bis August 2014 an der Universität Flensburg in der Abteilung „Inklusion und pädagogische Entwicklungsförderung“ des Instituts für Sonderpädagogik angestellt sowie im Sommersemester 2014 als Lehrbeauftragte an der Universität Heidelberg.
09.06.2015, 18-20 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 221
On My Watch - Ist kritischer Journalismus in Japan (noch) möglich?
Carsten Germis
Carsten Germis ging im Januar 2010 als Wirtschaftskorrespondent der F.A.Z. für Ostasien nach Tokio. Dort erlebte er im März 2011 das verheerende Erdbeben und die Atomkatastrophe in Fukushima. Seit Januar 2012 berichtete er aus Japan und Südkorea auch für die politische Redaktion. Zudem war er im Vorstand des Foreign Correspondants' Club of Japan (FCCJ) aktiv. Im April 2015 kehrte er zurück nach Deutschland und berichtet seither mit Sitz in Hamburg über Wirtschaft und Unternehmen im Norden der Bundesrepublik.
Unter dem Titel "On My Watch. Confessions of a foreign correspondant after half a decade of reporting from Tokyo to his German readers" erschien in der April-Ausgabe des FCCJ-Magazins (Number 1 Shimbun, 47/4, S. 6-7) sein kritisches Fazit zum Wandel der Arbeitsbedingungen ausländischer Journalisten in Japan. So nehme das japanische Außenministerium seit 2014 zunehmend Einfluss auf die Berichterstattung über Japan in den internationalen Medien. Carsten Germis selbst ebenso wie auch die F.A.Z. Redaktion in Deutschland habe entsprechenden Druck zu spüren bekommen. Er resümiert: "Anyone who criticizes the brave new world being called for by the prime minister is called a Japan basher."
In seinem Vortrag teilt Carsten Germis Einblicke in den Arbeitsalltag ausländischer Korrespondenten in Japan und setzt sich dabei kritisch mit den jüngsten Entwicklungen unter der Abe-Administration auseinander.
30. März 2015
In memoriam Manfred Pohl
(13. Juni 1943 - 30. März 2015)
Manfred Pohl war durch und durch Hamburger: verwurzelt im Norden, zugleich weitgereist und weltgewandt. Aufblühend in seinem Garten in Langenhorn und doch stets angetrieben von der Neugierde auf neue Perspektiven, seinen Blick zielgerichtet auf alles, das jenseits der Grenzen des Bekannten lag. Seine feste Erdung und seine dynamische Wissbegierde haben ihn in ihrem Zusammenwirken zu dem Wissenschaftler werden lassen, der er war. Ein Pionier, einer der die Grenzen seines Fachs, der Japanologie, auf der Grundlage einer umfassenden Ausbildung zu erweitern suchte. Dies gelang ihm in unvergleichlicher Manier. Manfred Pohl prägte das Feld der sozialwissenschaftlichen Japanforschung nachhaltig. Er erschloss es gewissermaßen und machte es für die nachfolgenden Wissenschaftlergenerationen zugänglich.
Nach seinem Abitur am Gymnasium im Alstertal begann Manfred Pohl 1965 mit dem Studium der Japanologie, Geschichte, Politikwissenschaft und Sinologie an der Universität Hamburg. Er promovierte 1973 bei Oscar Benl mit einer Arbeit über „Die Bauernpolitik der Kommunistischen Partei Japans (1922–1928)“ (Mitteilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens e.V., 1976). An die Zeit als Assistent am Seminar für Sprache und Kultur Japans der Universität Hamburg (1973–1975) schloss sich seine Laufbahn als wissenschaftlicher Referent am Institut für Asienkunde (IfA), ebenfalls in Hamburg, an. Seine Tätigkeit am IfA, dem Vorläufer des heutigen GIGA Instituts für Asien-Studien, erstreckte sich über zwei Dekaden (1975–1994), in denen Manfred Pohl durch sein intensives Engagement in der Politikberatung und der Medienarbeit das deutsche Japanbild maßgeblich bestimmte. Neben der Politik und Wirtschaft Japans zählten zu seinen dortigen Tätigkeitsbereichen auch die Politik und Wirtschaft Singapurs, der beiden Koreas sowie Japans internationale Beziehungen zur ASEAN. Nach seiner Berufung auf die Professur für Staat, Politik und Gesellschaft Japans an der Universität Hamburg im Jahr 1994 setzte er sein Engagement für den Wissenstransfer in Politik und Öffentlichkeit unermüdlich fort. Zugleich widmete er sich, auch noch weit über seine Emeritierung im Jahr 2008 hinaus, mit Leidenschaft und stets einer Spur von Humor der Ausbildung des (wissenschaftlichen) Nachwuchses. Im Jahr 2011 wurde Manfred Pohl in Anerkennung seiner Verdienste um die Japanforschung und den japanisch-deutschen Wissenschaftsaustausch von Seiner Majestät Kaiser Akihito der „Orden der Aufgehenden Sonne am Halsband, Goldene Strahlen“ verliehen.
Eine Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen zeugt von seinen Verdiensten um die Japanforschung. Stellvertretend seien hier genannt der Länderband „Japan“ (Hg., Thienemann 1986), der Länderband „Korea“ (Hg. mit Rüdiger Machetzki, Thienemann 1988), die aktuelle Länderkunde „Japan“ (C.H. Beck, 1. Auflage 1991), der „Länderbericht Japan“ (Hg. mit Hans Jürgen Mayer, Bundeszentrale für Politische Bildung, 1. Auflage 1994) und die „Geschichte Japans“ (C.H. Beck, 1. Auflage 2002). Seine Bücher wurden weit rezipiert; die „Geschichte Japans“ zum Beispiel, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung (29.10.2002, S. 43, Steffen Gnam) einst als „pointierte[n] Schnelldurchgang ohne Fisimatenten“ pries, erschien erst 2014 in ihrer 5. aktualisierten und erweiterten Auflage. In Kollegenkreisen wurde das ein oder andere Mal darauf hingewiesen, dass Manfred Pohls Publikationen mit ihrem überblicksartigen Charakter „Mut“ erforderten; so zum Beispiel von Erich Pauer in einer Buchrezension zur aktuellen Länderkunde „Japan“, erschienen in Japan aktuell (1992, April/Mai, S. 37). An derselben Stelle heißt es weiter, die Länderkunde sei „eine facetten- und faktenreiche, flott und handfest geschriebene Einführung, die ihrem Auftrag, einen ersten Einblick in die japanische Landeskunde zu vermitteln, voll gerecht wird“, auch wenn „[d]ie Puristen unter den Japanologen [...] beim Anblick dieses Buches vielleicht wieder die Nase rümpfen [werden], wagt es hier doch der Autor, sich in die sogenannten ‚Niederungen’ der populären Japandarstellung zu begeben“. Mit seinem dezidierten Anspruch auf eine Anwendbarkeit seiner Publikationen forderte er in der Tat so manchen „Puristen“ des Fachs heraus. Er tat dies wohlüberlegt. Der Verfasserin dieses Textes sagte er einmal: „Ich schreibe für die deutsche Öffentlichkeit. Sie ist mein Publikum“.
Manfred Pohl war zudem Gründungsherausgeber der IfA-Zeitschrift „Japan aktuell“ (ab 1993), die analytische Beiträge ebenso aufnahm, wie sie auch den Leitgedanken des „Kagami“, an dem er ebenfalls redaktionell beteiligt gewesen war, wieder aufgriff. Dieser „Japanische Zeitschriftenspiegel“, dessen Anfänge auf das Jahr 1962 zurückgehen, hatte es sich zum Ziel gesetzt, durch Übersetzungen ausgewählter Beiträge japanischer Printmedien der deutschen Öffentlichkeit „einen Eindruck von den aktuellen Lebensfragen Japans“ (Kagami 1962, 2, S. I, Vorwort des Hg. Robert Schinzinger) zu vermitteln. In seinen zahlreichen Publikationen, auch gerade in den populärwissenschaftlichen, blieb der Transfer des Wissens um die gegenwärtigen Entwicklungen Japans stets ein Anliegen Manfred Pohls. So fand er als Autor in Zeitungen und als Diskutant in Radio und Fernsehen eine weitere erfüllende Rolle. Erst im April 2013 beispielsweise erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter dem Titel „Die Lehrjahre des jungen Diktators“ seine scharfsinnige Analyse zum politischen Wandel in Nordkorea, einem Land, das er so gut wie nur wenige andere aus erster Hand kannte.
Besonderes Augenmerk soll dem Jahrbuch „Japan – Wirtschaft, Politik, Gesellschaft“ zuteilwerden, das Manfred Pohl bereits im Jahr 1977 begründete. Es etablierte sich rasch unter den Lehrenden und Studierenden der Japanologie, der sozialwissenschaftlichen Disziplinen und in der interessierten Öffentlichkeit als wertvolle Überblickspublikation zu aktuellen Entwicklungen Japans. Information, Analyse und Kontextualisierung – sie spiegeln sich im Format des Jahrbuchs. Man mag dieses „Dreigestirn“ auch als Manfred Pohls Anspruch an die zeitgenössische Japanologie verstehen. Das Japan-Jahrbuch wird mittlerweile unter dem Schirm der Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Japanforschung (VSJF) weiter betrieben; seit 2014 erscheint es im iudicium Verlag in München. Manfred Pohl verfasste bis einschließlich der Ausgabe 2014 nahezu alljährlich den Abschnitt zu den innenpolitischen Entwicklungen.
Der VSJF sprach er im Japan-Jahrbuch 2013 (S. 40–41) anlässlich ihres 25jährigen Jubiläums das Verdienst zu, die Japanforschung bunter gemacht zu haben, auch wenn er selbst, nach eigener Aussage, der Gründung der Vereinigung im Jahr 1988 skeptisch gegenüberstand. Damals, so Manfred Pohl, hatte er „die Universität [Hamburg] längst verlassen und glaubte, das endgültige Ende jener Lebensstrecke erreicht zu haben, die ich [M.P.] für eine bedrohliche Gefahrenzone akademischen Aquaplanings hielt, weit entfernt von Realitätsbezügen“. Er habe sich selbst damals als Vertreter einer Nachwuchsgeneration gesehen, in der nur Einzelne zu finden waren, für die „Texte […] vom Forschungsgegenstand zum Hilfsmittel [wurden], zum Werkzeug für politikwissenschaftliche, historiographische – ja auch: soziologische Ansätze“. Nicht nur lassen diese Passagen Manfred Pohls einzigartige Fähigkeit zur pointierten Zuspitzung seiner Gedanken erkennen, sie zeugen auch von seinem intensiven Ringen mit dem Fach. Er hielt an der Notwendigkeit einer umfassenden japanologischen Ausbildung, insbesondere an der zentralen Rolle der Sprachausbildung fest, und doch rief er zum Perspektivwechsel auf: „Vom Forschungsgegenstand zum Hilfsmittel“ sollten die Quellen werden. Die – in seinem Fall sozialwissenschaftliche – Disziplin sollte in den Vordergrund des Selbstverständnisses des Forschers rücken. Noch heute befände er sich mit dieser Positionierung im Zentrum japanologischer Debatten,und während der Hundertjahrfeier der Hamburger Japanologie im Dezember 2014 machte er genau dies nochmals deutlich. Diese Debatten um den Charakter des eigenen Fachs jedoch überhaupt mit angestoßen zu haben, zählt zu seinen großen Verdiensten um die Japanologie.
Sein Gedächtnis, so bescheinigen ihm alle, die ihn kannten, bewahrte eine unglaubliche Menge an Informationen, Namen und Ereignissen auf, die jederzeit abrufbar waren und die er auf eine ausgefallene, oft humorvolle Art miteinander zu verknüpfen wusste. Seine Vorträge und Vorlesungen waren ausdruckstark, unterhaltsam und garniert mit feiner Ironie – insbesondere dann, wenn er die Tiefen und Fallstricke des politischen Systems Japans analysierte. Zugleich basierten seine Aussagen auf fundiertem Wissen. Diese Qualitäten machten ihn zu einem gefragten öffentlichen Redner und einem beliebten Lehrer. Die Verfasserin dieser Zeilen, selbst eine Schülerin (eine „Doktortochter“) Manfred Pohls, erinnert sich noch genau an seine wunderbare Fähigkeit, auch die richtigen Fragen zu stellen. Fragen, die überaus inspirierend wirkten, neue Perspektiven eröffneten und nun schmerzlich vermisst werden müssen.
Manfred Pohl liebte die Literatur und die bildenden Künste. Seine malerische Begabung hat er wohl von seinem Vater, einem Steinmetzmeister, geerbt. Er zeichnete viel und malte gelegentlich Aquarelle, sehr gerne auch Neujahrskarten. Sogar einen Stempel mit seinem japanischen Künstlernamen besaß er. Ein leidenschaftlicher Fotograf war er außerdem, mit einem scharfen Blick für das Schöne, das Ungewöhnliche und das Lächerliche. Sein Fotoarchiv gibt Zeugnis von verschiedensten Orten Europas und Asiens seit den 1960er Jahren, die er auf seinen zahlreichen Reisen besuchte. Bis zuletzt war er mit großer Neugier in den entlegensten Winkeln der Welt unterwegs. Er interessierte sich für Stadtentwicklung und Architektur und war ein politisch wacher Mensch mit einer offenen Nähe zur Sozialdemokratie. Wie passend, dass er in einer nach Fritz Schumacher benannten Genossenschaftssiedlung wohnte!
Manfred Pohl war im Privaten wie im Beruflichen ein Hamburgischer Kosmopolit, den Blick stets auf den Horizont gerichtet. Vor allem aber war Manfred Pohl ein Familienmensch. Ein präsenter Vater, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau den gemeinsamen Sohn alleine großzog. In den letzten Jahren dann genoss er seine neue Rolle als liebevoller Großvater. Er kümmerte sich viel um andere und manchmal ahnte man die Gefahr, dass er dabei sich selbst vergessen könnte.
Am 30. März 2015 verstarb Manfred Pohl in Hamburg. Viel zu früh.
Gabriele Vogt
20.01.2015, 18:00-20:00 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 121
Imagining and Living the Family: Attitudes from young-ish adults in urban Japan
Glenda S. Roberts, Waseda University
In recent decades, Japan has become a rapidly aging, low birthrate society. Late marriage and no marriage have also become commonplace. With the prolonged recession, stable, regular employment declined, wages declined, and the prototypical 'salaryman' male of the postwar period took a beating. In this milieu, how do young adults feel about gender roles in marriage? Have attitudes changed in regard to marriage and childrearing, and if so, how? How do the unmarried imagine themselves in the future, and how do the married wish to rear their children?
Through this interview study we can discern a range of diverse views, but those in regard to childbearing and rearing in particular remain fairly conservative. Furthermore, expectations that women should take on the 'double shift' of household labor and caregiving upon marriage, as well as continued discrimination against women in the workplace, underlie the hesitancy young adults experience in acting on their dreams in the recessionary economy. The data from this work in progress come from a qualitative survey of eight men and eight women ages 23-39, as part of a larger survey research project of the East-West Center's Population and Health Research Program on Family Change in Asia.
Glenda S. Roberts is a socio-cultural anthropologist specializing in gender, work, family, and migration. She is Professor at the Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University. Among her most recent publications are, co-edited with Satsuki Kawano and Susan Long, Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty (University of Hawaii Press, 2014), and "Salary Women and Family Well-Being in Urban Japan," in Marriage & Family Review, 47:571-589.
13.01.2015, 18:00-20:00 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 120
Writer in residence” in Ôsaka
Gespräch mit dem Hamburger Schriftsteller Matthias Politycki
Anläßlich der Feiern zum 25jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Hamburg–Ôsaka im Jahr 2014 entschied sich die Kulturbehörde der Stadt Hamburg, einen Hamburger Schriftsteller nach Ôsaka zu entsenden. Zum einen sollte er anhand von Lesungen und Begegnungen vor Ort als „Kulturbotschafter“ der Stadt fungieren, zugleich aber auch als Autor, der diese Erfahrungen wiederum in literarische Werke überführen kann.
Die Wahl fiel auf den Schriftsteller Matthias Politycki, der bereits 1993 mit Taifun über Kyôto einen Roman vorgelegt hatte, in dem geschickt und mit großer Sachkenntnis japanische Bezüge eingewoben sind. An diesem Abend werden wir versuchen, im Gespräch mit dem Autor mehr von seinen aktuellen Japanerfahrungen zu hören, von seinen früheren Begegnungen mit dem Land und seiner Kultur, sowie einen kleinen Einblick in die Textwerkstatt seiner Zeit in Ôsaka zu bekommen. Matthias Politycki (1955*) gehört zu den profiliertesten deutschsprachigen Autoren der letzten Jahrzehnte. Nach einer frühen sprachexperimentellen Phase schrieb er unter anderem den von der Kritik hochgelobten und erfolgreichen Weiberroman (1997), kürzlich erschien der Roman Samarkand Samarkand (2013). Politycki ist aber seit seinen literarischen Anfängen auch Dichter und hat eine ganze Reihe von Gedichtsammlungen veröffentlicht. Gedichte (etwa: „Sonnenuntergang. Vorletztes Tanka des Hideyoshi Toyotomi“, „Mein Sake ist traurig“) sind auch ein Ergebnis des Aufenthaltes in Ôsaka.
Veranstaltungen 2014
13.12.2014, 14:30-17:00 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 124
Japanese Text and Japanese Language Education Workshop, the Graduate School of Humanities, Kobe University
Kobe University Graduate School of Humanities is collaborating with Hamburg University, through a project funded by JSPS. We are conducting joint research into creating standards for introducing literary works into language education from the standpoint of understand different cultures, and also actively sending young researchers on internship programs for education related to Japanese language and culture. As part of this initiative we will hold a search meeting on education for Japanese as a foreign language and Japanese culture.
Program
11.-12.12.2014
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost
Festakt und Festsymposium - 100 Jahre Japanologie in Hamburg
Programm
11.12.2014, 12:00-13:30 Uhr 
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 121
Neoliberal Motherhood: Care and Work in Japanese Welfare State
Mari Miura (Sophia University, Tokyo)
Women in general, and working mothers in particular, occupy a strategic position in Japan’s welfare capitalism. In order to generate economic growth amid the shrinking labor force, policy makers have recognized the importance of pushing women into the labor market. At the same time, the low birth rate has propelled them to pursue work-life balance policy as well as childcare policy. Recently, “womenomics” discourse also penetrated growth strategy, which justifies positive action measures. Nevertheless, these seemingly working-women friendly polices have not yielded concrete result.
My presentation asks why numerous women friendly policies are at best schizophrenic, if not contradictory with each other. More broadly, I explore why gender inequality has persisted in Japan, identifying the position of women in policy discourses and partisan debate. I focus on the blending of neoliberalism and statist family ideology held by the dominant party, Liberal Democratic Party (LDP), which I label “neoliberal motherhood” to explain Japan’s schizophrenic policy response. Women’s body is objectified in the neoliberal project as well as in the statist family ideology.
Neoliberalism is gender-neutral in itself, expanding opportunities for women in paid work, yet serves to stratify women thereby producing poor women on a massive scale. Statist family ideology legitimatizes the state’s control of family formation as well as precludes the family from becoming a burden to the state. What it protects is motherhood, not actual mothers, as self-sacrifice is the essence of motherhood in their thinking.
Enlargement of the working poor caused by neoliberal labor and welfare policy created a fertile soil for the discourse of statist family ideology to be accepted. Although neoliberalism and motherhood might appear at odds with each other, the common thread that ties them up—the objectified women—permits their strange marriage.
Mari Miura serves as a Professor in the Faculty of Law at Sophia University in Tokyo. She is a graduate of Keio University and holds a PhD from the University of California at Berkeley. She has published widely on Japan’s political system including party politics and welfare policies. Among her recent publications is: Welfare Through Work. Conservative Ideas, Partisan Dynamics, and Social Protection in Japan (Cornell University Press, 2012).
09.12.2014, 14:00-16:00 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 120
Is Japan Shifting to the Right?
Koichi Nakano (Sophia University)
There is much discussion today over whether Japan is shifting to the right. Particularly since Prime Minister Abe Shinz? returned to office in December 2012, controversies surrounding the so-called “history” issues, including the Yasukuni Shrine and the comfort women (sex slaves) problems, returned to the center stage of domestic politics as well as international affairs, and combined with the territorial disputes and concerns over security, aggravated the tensions in the Northeast Asian region.
Some of Abe’s critics in China and South Korea, for instance, have drawn attention to the revisionist beliefs and nationalist views held by the Prime Minister and his entourage, and at times, have gone so far as to sound the alarm that Japan may be returning to militarism. Even inside Japan, a growing number of civic activists and ordinary citizens took to the streets to protest against Abe’s enactment of the Protection of Designated Secrets Law and the change of the interpretation of the constitution to lift the ban on the country’s right of collective self-defense, with the chant “Down with the Fascist!”
While an increasing number of scholars and journalists started to express serious concerns over Abe’s historical revisionism and authoritarian politics (and their potential implications), there are those who contend that these concerns are exaggerated, if not simply misguided.
While it is true that the nationalist elements within the LDP have always existed since its founding, and while it is also true that the rise of China has given reasons for Japan to rethink its security strategy, a central claim that will be made in this lecture is that there has indeed been a shift to the right in Japanese politics in the past couple of decades.
Koichi Nakano is Professor of Political Science at the Faculty of Liberal Arts, Sophia University. Ph.D. (Princeton). His research has focused on a variety of issues of Japanese politics, including neoliberal globalization and nationalism, and the Yasukuni problem. His publications in English include articles in The Journal of Japanese Studies, Asian Survey, The Pacific Review, Governance, a chapter on “‘Democratic Government’ and the Left” in Rikki Kersten and David Williams (eds.): The Left in the Shaping of Japanese Democracy (Routledge, 2006), and a single-authored book entitled Party Politics and Decentralization in Japan and France: When the Opposition Governs (Routledge, 2010).
17.11.2014, 14:00-16:00 Uhr
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 120
Politics and Policies under Abe Shinzō
John C. Campbell (University of Michigan, Ann Arbor and Tokyo University)
The last two years have been quite distinctive in postwar Japanese history. Politics is about power, and Abe has maintained unprecedented power in the whole political system: vis-à-vis the other parties in the Diet, the bureaucracy in the government, and potential opposition within the ruling Liberal Democratic Party. That is largely due to favorable conditions—parliamentary majorities in both houses and unusually weak competitors on all fronts—but much of the credit must go to Abe’s imagination and determination, and his strategic and tactical skills.
Politically the most striking point is Abe’s success in maintaining public support, despite the declining economy and widespread criticism of many of his policies: the secrets protection law, constitutional reinterpretation for collective self-defense, nationalistic historical revisionism, and hiking the consumption tax.
Currently Abe is beset by financial mini-scandals among cabinet ministers, and he faces a tricky foreign and domestic policy agenda: disputes over trade with the United States, containing China, weakening job protection and trimming social programs, whether to go through with the second consumption tax hike, and more generally getting the economy back on track. He clearly is focused on the local elections coming in the spring. Still, he is in a strong position and so far has been able to deal with adversity, so it is a very interesting time in Japanese politics.
John Creighton Campbell is Professor Emeritus of Political Science at the University of Michigan, Ann Arbor and currently serves as a project researcher in the Institute of Gerontology at Tokyo University. Among his many publications is How Policies Change: The Japanese Government and the Aging Society (Princeton University Press), winner of the 1993 Ohira Memorial Prize.
12.09.2014 bis 13.09.2014, 14:00-18:00 Uhr
Warburg-Haus, Universität Hamburg, Heilwigstraße 116
Europäische Japandiskurse 2014: Literatur und Gesellschaft
Seit den frühesten literarischen Phänomenen spielt das Verhältnis der einzelnen Genres und ihrer Funktionen mit den gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer sie entstehen und sich weiterentwickeln, eine außerordentlich wichtige Rolle in Japan. Neben wichtigen Beispielen für diese pragmatische Seite der japanischen Literatur widmet sich das Symposion aber auch der Frage, wie literarische Texte zugleich als Quelle für gesellschaftliche Wirklichkeiten befragt werden können.
Programm
Sommersemester 2014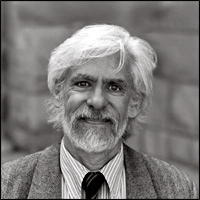
Wir freuen uns, in diesem Sommersemester als Numata-Professor einen der renommiertesten Spezialisten für den Buddhismus des japanischen Mittelalters bei uns zu Gast zu haben, Carl Bielefeldt, “Walter Y. Evans-Wentz Professor of Oriental Philosophies, Religions, and Ethics” an der Stanford University.
Prof. Dr. Bielefeldt hat sich insbesondere mit der geistesgeschichtlichen Tradition des Zen-Buddhismus in Ostasien beschäftigt. Er ist Verfasser des Buchs Dôgen’s Manuals of Zen Meditation und anderer Werke über die Anfänge des japanischen Zen. Darüber hinaus wirkt er als Herausgeber des Sôtô Zen Text Project.
Neben einer Einführung in das Lotossûtra im Rahmen des Studiengangs “Buddhist Studies” gibt Carl Bielefeldt einen Lektürekurs zum Shôbôgenzô.
3. Juli 2014, 14-16 Uhr
Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 121
Prekäre Arbeit, polarisierte Politik? Die Ausweitung nicht-regulärer Beschäftigung in Japan und die Folgen für die Politik
Steffen Heinrich (Universität Duisburg-Essen IN-EAST)
Steffen Heinrich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute of East Asian Studies (IN-EAST) der Universität Duisburg-Essen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den politischen Dimensionen von Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtsstaatsreformen in Deutschland, Japan und anderen OECD-Ländern. In seiner 2013 abgeschlossenen Dissertation hat er die Rolle von Institutionen und Parteipolitik für Arbeitsmarktreformen in Deutschland und Japan untersucht.
In Japan sind heute fast 40% aller abhängig Beschäftigten nicht regulär beschäftigt: sie verfügen nur über einen befristeten Arbeitsvertrag, werden kurzfristig an Arbeitgeber verliehen und/oder arbeiten nur eine reduzierte Anzahl von Stunden. Sie verdienen deutlich weniger als Beschäftigte in traditionellen Angestelltenverhältnissen und sind benachteiligt im Hinblick auf betriebliche und staatliche Sozialleistungen.
Die Zweiteilung des Arbeitsmarktes in gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze einerseits und in nicht-reguläre, häufig prekäre Arbeitsplätze andererseits wird auch politisch immer bedeutsamer. Die Interessen von regulären und nicht-regulären Arbeitnehmern unterscheiden sich deutlich in zentralen Fragen wie beim Kündigungsschutz oder staatlichen Unterstützungsleistungen. Die fehlende Mobilität zwischen den Beschäftigungsformen vertieft zudem den Graben. Es treten also Interessenskonflikte zwischen Wählergruppen abhängig von ihren Beschäftigtenstatus auf, welche die Parteipolitik dauerhaft verändern können. Auch in Japan spielen Beschäftigung und Arbeitsmarkt eine immer größere Rolle bei der Wählermobilisierung – etwa bei der historischen Unterhauswahl von 2009, als erstmals eine Oppositionspartei die Wahlen gewann.
Der Vortrag diskutiert zunächst die sozialen Implikationen nicht-regulärer Beschäftigung in Japan und geht dann den politischen Auswirkungen anhand von Umfragedaten und parteipolitischen Statements nach. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zu europäischen Ländern mit ähnlichen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, z.B. Deutschland. Dies gilt insbesondere für die anhaltend große politische Bedeutung lebenslanger Beschäftigungsmodelle typisch für Großunternehmen sowie für den Einfluss des japanischen Wohlfahrtssystems auf Wählerpräferenzen.
24. Juni 2014, 18-20 Uhr
Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, Raum 221
"Saving 10,000. Winning a War on Suicide in Japan" Filmvorführung & Podiumsgespräch
Im Gespräch:
INGER M. BACHMANN, M.A. (Japanologie/Politikwissenschaft)
ANNE BERGT (Psychologie)
PROF. DR. ULRICH DEHN (evangelische Theologie)
24. Mai 2014
Ort: ESA-1 Ost
"Japantag 2014"
Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Japantag geben, den das Japanische Konsulat Hamburg zusammen mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Hamburg (DJG) und der Abt. für Sprache und Kultur Japans am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg veranstaltet.
Wie in den früheren Jahren werden viele unterschiedliche Aspekte der japanischen Kultur anhand von Workshops oder Vorführungen vorgestellt und erlauben so einen unmittelbaren Zugang zu "Land und Leuten". Darüber hinaus können sich bei dieser Gelegenheit Organisationen und Gruppen, die zur deutsch-japanischen Begegnung in der Region Hamburg beitragen, mit ihren Aktivitäten präsentieren.
28. April 2014, 18-20 Uhr
Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal J
Partizipation nach Fukushima: Mütter gegen Radioaktivität
Phoebe S. Holdgrün (Deutsches Institut für Japanstudien)
Nach der Dreifachkatastrophe in Japan vom 11. März 2011 sind viele Menschen in social movement organizations aktiv geworden, die sich – zu einem großen Teil – aus Sorge um die Folgen der Atomreaktorkatastrophe von Fukushima neu gegründet haben.
Die Lage in Japan seit März 2011 hat besonders Eltern dazu bewegt, sich für den Schutz ihrer Kinder vor radioaktiv verstrahlter Nahrung und Umwelt zu engagieren. Dies zeigt sich z.B. in einem seither gegründeten, japanweiten Elternnetzwerk von über 300 Organisationen. Innerhalb dieses Netzwerkes gibt es Vereinigungen von Eltern, die sich an international sichtbaren Protestaktivitäten gegen die Nutzung von atomarer Energie beteiligen. Andere Gruppen wiederum lehnen die Teilnahme an Demonstrationen und Protestveranstaltungen ab und ziehen andere Wege der Partizipation vor, um das Ziel einer sicheren Umwelt für ihre Kinder zu erreichen.
Dieser Vortrag präsentiert Partizipations-strategien dieser vergleichsweise „unsichtbaren“ Mitglieder der japanischen Zivilgesellschaft anhand einer Fallstudie des in allen 23 Tokyoter Bezirken vertretenen Netzwerkes NO! Hoshanō Tokyo rengō kodomo mamorukai (Netzwerk von Organisationen zum Schutz der Kinder vor Radioaktivität in Tokyo).
Das Fallbeispiel zeigt, dass sich v.a. Mütter in den lokalen Vereinigungen engagieren. Gleichzeitig verdeutlichen erste Ergebnisse der Studie, dass innerhalb der Organisationen hohes Sozialkapital entsteht, wohingegen die Einflussnahme auf die Lokalregierungen beschränkt zu bleiben scheint. Die beteiligten Frauen werden aus ihrem Verständnis der Mutterrolle heraus aktiv. Diese Sichtweise wirkt sich fortwährend auf die Partizipationsstrategien aus, die auf den ersten Blick unkoordiniert wirken, sie zielen jedoch auf kontinuierliche und langfristige Kontrolle der lokalen Maßnahmen gegen radioaktive Verstrahlung ab.
Phoebe Stella Holdgrün promovierte 2011 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die Dissertationsschrift erschien 2013 unter dem Titel Gender equality. Implementierungsstrategien in japanischen Präfekturen (iudicium). Seit 2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Japanstudien. Am DIJ befasst sie sich mit dem Stellenwert von politischer Partizipation im Leben von Aktivisten und dem Zusammenhang zu subjektivem Glücksempfinden. Das Projekt „Eltern gegen Radioaktivität. Eine Fallstudie“ koordiniert sie gemeinsam mit Barbara Holthus (Universität Wien).
08. Februar 2014 Samstag, 15-17 Uhr
Ort: ESA-1 Ost, Raum 122
"Tradition trifft Moderne" - Ein Workshop mit der Instrumentalgruppe Wasabi
Teilnahme nur nach Voranmeldung!
Die Gruppe Wasabi versucht sich an einer ungewöhnlichen Kombination von vier traditionellen japanischen Instrumenten: Tsugaru-shamisen (jap. Saiteninstrument), shakuhachi (Bambusflöte), koto (jap. Wölbbrettzither), taiko (Trommeln). Auch ihr Repertoire, das klassische Elemente mit Volksmusik verbindet und trotzdem modern ist, zeichnet sich durch Kreativität aus. Entsprechend groß ist das mediale Interesse an der Gruppe, besonders seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Wasabi im März 2011, sowohl in Japan als auch im Ausland.
Die Instrumentalgruppe geht auf ein Projekt im Jahr 2008 unter dem Titel „The Spirit of Japan: The Sound of Traditional Instruments“ zurück. Yoshida Ryōichi (*1977), der ältere der bekannten Shamisen-Gruppe Yoshida kyōdai (Yoshida Brothers), eine Kollaboration mit Motonaga Hiromu (shakuhachi) und Bihō Naosaburō (Trommeln, Percussions). Mit Ichikawa Shin (koto) bilden die Musiker seit 2010 die Gruppe Wasabi.
Die Gruppe ist anlässlich eines kostenfreien Konzertes am 09.20.2014 in Hamburg. Am Vorabend wird die Gruppe Wasabi einen Workshop im Asien-Afrika-Institut abhalten, bei dem die Teilnehmenden die Instrumente vorgestellt bekommen und selbst erfahren können. Der Workshop wird von der Abteilung für Sprache und Kultur Japans, dem japanischen Konsulat zu Hamburg und dem Japanischen Kulturinstitut Köln ausgerichtet.
20. Januar 2014 Montag, 18-20 Uhr
Ort: ESA-1 (Hauptgebäude), Hörsaal K
Das Internet als Forschungsgegenstand am Beispiel japanischer religiöser Heiler
Dr. Birgit Staemmler (Universität Tübingen) In den letzten Jahre ist das Internet nicht nur eine zentrale Quelle für sekundäre Information – digitalsierte Texte, Lexika usw. – geworden, sondern gewinnt berechtigterweise auch als Forschungsgegenstand wachsende Aufmerksamkeit. Dieser Vortrag stellt darum verschiedene Arten von Internetpräsenzen und ihre mögliche Aussagekraft vor und erläutert Methoden ihrer Erfassung und Analyse. Als konkretes Beispiel dienen japanische religiöse Heiler, die ja durch ihre Internetauftritte Kunden werben wollen.
In Zusammenarbeit mit dem Studiengang Religionswissenschaften / Institut für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaften –
16 January 2014 Thursday, 6.15 pm
Ort: ESA-1 (Hauptgebäude), Hörsaal K
What is "Washoku" and Why it Matters
Katarzyna J. Cwiertka, Leiden University
Food and heritage take on multiple meanings and configurations in contemporary world. While food culture and traditions associated with it are central to claims of ethnic and regional distinctiveness, and on the levels of nations as a whole become the basis for asserting collective identity and distinctiveness, growing flows of travel, food trade, and other connections across national boundaries have rendered notions of food culture and heritage even more fluid.
This already complex relationship acquired an additional dimension in 2010, when UNESCO for the very first time placed food on their list of Intangible Cultural Heritage (ICH). Culinary categories designated as ICH that year were: 'Gastronomic meal of the French', 'Traditional Mexican cuisine', 'Mediterranean diet' and 'Gingerbread craft from Northern Croatia'. In spring of 2012 Japan followed with its own proposal for washoku ('Japanese cuisine') and UNESCO's decision about this entry is expected to be reached by the end of this year.
This lecture explores the factors that motivated the popularisation of Japanese cuisine worldwide since the 1980s to the present, and far-reaching consequences of this trend. It also raises general questions about the nature of culinary identity-making as national policy in the contemporary global context, as it is represented by the recent efforts of the Japanese government to promote Japanese cuisine as distinctive and worthy of international recognition.
Katarzyna J. Cwiertka is Professor of Modern Japan Studies at Leiden University (The Netherlands). Her research to date has utilized food as a window into the modern history of Japan and Korea. Cwiertka is the author of Modern Japanese Cuisine: Food, Power and National Identity (Reaktion Books 2006) and Cuisine, Colonialism and Cold War: Food in Twentieth-Century Korea (Reaktion Books 2012), and the editor of Asian Food: The Global and the Local (University of Hawaii Press 2002), Critical Readings on Food in East Asia (Brill 2012) and Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia (Ashgate 2013).
Veranstaltungen 2013
17. Dezember 2013 Dienstag, 18-20 Uhr
Ort: ESA-1 (Hauptgebäude), Hörsaal J
A True Novel and Wuthering Heights: the Formation of Modern Japanese Literature
MIZUMURA Minae
On how Japanese translations of Western novels acted as the basis for the formation of modern Japanese literature. At the same time, the famous Japanese writer MIZUMURA Minae will present the first English translation of her novel titled “A True Novel” (jap. Honkaku shôsetsu, 2002).
28. November 2013, Donnerstag, 19-21 Uhr
Ort: KörberForum - Kehrwieder 12, 20457 Hamburg (U3 Station Baumwall)
Japan unter Abe: Reform oder Rückschritt?
Der Ende 2012 gewählte Premierminister Shinzo Abe initiierte zahlreiche Wirtschaftsreformen, um Japan wieder wettbewerbsfähig zu machen. Seine sogenannten »Abenomics« sind wegen ihres wirtschaftsliberalen Ansatzes umstritten.
Auch andere Reformen machen seinen Kritikern Sorgen, denn Abe ist für nationalistische Rhetorik bekannt. Er strebt eine Reform der pazifistischen Nachkriegsverfassung an. Dies gilt insbesondere für die Abschaffung oder Neuauslegung von Artikel 9. Der Artikel verbietet es Japan bislang, sein Militär jenseits der Selbstverteidigung einzusetzen. Dies sorgt für Unruhe in der Region. Die ohnehin angespannten Beziehungen zu Japans wichtigstem Handelspartner China werden dadurch weiter auf die Probe gestellt. Diese sind jedoch essentiell, um die japanische Wirtschaft wieder zu beleben. Knapp ein Jahr nach Abes Amtsantritt wird der japanische Professor Jun Iio die Veränderungen in Japan auf innenpolitischer und außenpolitischer Ebene genauer beleuchten.
Mit Jun Iio, Professor am GRIPS (National Graduate Institute for Policy Study), Tokio und Gabriele Vogt, Professorin am Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg.
Japanisch/Deutsch mit Übersetzung
27. November 2013 Mittwoch, 12:15-13:45 Uhr
Ort: ESA 1 (Ost), Raum 124
Krieg der Zeichen – e-Humanities und die digitale Repräsentation klassischer japanischer Texte
Prof. Dr. Robert Horres (Universität Tübingen)
Das japanische Schriftsystem gehört, weltweit gesehen, zu den komplexeren Systemen. Dabei sind die Schwierigkeiten bei historischen Texten noch um ein erhebliches höher, weil es keine normative Institutionen, allenfalls Schul- oder Genregewohnheiten gab.
Der Vortrag beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen einer Computerphilologie im Bereich der Japanologie. Vor dem Hintergrund aktueller technischer und wissenschaftspolitischer Entwicklungen werden dabei Beispiele für den praktischen Einsatz diskutiert.
Der Bereich der Computerphilologie wird hier sowohl unter Einbeziehung der Computerlinguistik als auch der historischen Fachinformatik betrachtet. Themen sind u.a. Digitalisierung und digitale Edition von historischen Texten, computergestützte Methoden der historischen Textforschung, digitale Wörterbücher sowie Probleme der Zeichenrepräsentation.
Prof. Dr. Robert Horres verantwortet seit 2004 den Arbeitsbereich „Modernes Japan“ an der Japanologie Tübingen, eine Schnittstelle zwischen den japanbezogenen Kultur- und Sozialwissenschaften und einer interkulturell orientierten Medien- und Informationswissenschaft.
Seine Arbeitsgebiete umfassen: Technik, Kultur und Gesellschaft in Japan (Forschungs- und Technologiepolitik; Technik, Medizin und Ethik; Biowissenschaften und Biotechnologie in Japan; Wissenschaft und Informatisierung in Japan), medienbasierte Erforschung kultureller Ressourcen sowie Neue Medien und ihre Didaktik in der Japanonologie.
Im besonderen Fokus seines Interesses stehen die Edierungsmöglichkeiten des bedeutenden mittelalterlichen Zen-Textes Shôbôgenzô von Dôgen (s. Abbildung).
26 November 2013 Tuesday, 6.15 pm
Ort: ESA-1 (Ost), Raum 221
Non-regular Workers Trapped in the Gap Between Changing Reality and (Almost) Unchanged Institutions
Yoshimichi Sato (Tohoku University)
We observe the increasing share of non-regular workers in the labor market in contemporary Japan. If there were no inequality between regular and non-regular workers, there would be no problem. However, this is not the case. Inequality in income, job security, social welfare, and social security exists between them. Why is there so huge inequality between them? This is the research question I will answer in this lecture.
My answer is that there is a widening gap between changing reality and (almost) unchanged institutions. I derive this answer from three theoretical building blocks: the functional theory of social stratification and its generalization, the theory of welfare-employment regime, and the theory of relationship between global forces, local institutions, and social inequality.
The core idea of the functional theory and its generalization is that social resources are allocated to social positions in society and that individuals compete for better positions. And based on the theory of welfare employment regime, we argue that the main characteristic of the Japanese welfare-employment regime is the realization of social security via employment security. This characteristic has made regular employment as a social position with employment security as well as social security. However, because the Japanese welfare-employment regime has become dysfunctional since mid-1990s, the share of male non-regular workers without such securities has increased.

Then why does the Japanese welfare-employment regime not catch up with changing reality? Based on the theory of the relationship between global forces, local institutions, and social inequality, global forces such as globalization and neo-liberalism indirectly affect social inequality via local institutions. And some institutions are slow in responding to global forces, while other institutions quickly respond to them. Institutions in the core of the labor market and the social stratification structure are of the former type. So we observe the widening gap between the changing reality and (almost) unchanged institutions.
Yoshimichi Sato is Distinguished Professor of Tohoku University. His recent research includes social inequality, the emergence of trust between strangers, and social change. His recent publications are Japan's New Inequality: Intersection of Employment Reforms and Welfare Arrangements (Trans Pacific Press, 2011) and Social Exclusion: Perspectives from France and Japan (Trans Pacific Press, 2012).
15. November 2013 Freitag, 14:30-15:30 Uhr
Ort: Warburgstraße 26
Written, Used, Discarded, and Unintentionally Preserved: Writings on Wood in Ancient Japan
Ellen Van Goethem (Kyûshû University)
– Im Rahmen der Konferenz “Manuscripts and Epigraphy” des SFB 950 –
This paper will provide an overview of the discovery, typology, and practical use of kodai mokkan, inscribed wooden tablets that were produced in large numbers between the seventh and tenth centuries in Japan.
While a small number of these mokkan had been carefully preserved for centuries in imperial repositories, the vast majority of the tablets was not discovered until recent decades. Excavations of sites mostly related to local or central government facilities, elite residences, and temples have yielded hundreds of thousands of inscribed tablets or shavings (kezurikuzu).
As a result, our understanding of various aspects of government, economy, and society in ancient Japan has changed and we have been allowed glimpses of the practical execution of government regulations and of daily life. Mokkan have also contributed to a better understanding of archaeological remains as they occasionally allow for precise dating and identification.
15.-27. Juli 2013 Intensivkurs Japanisch
Ort: Asien-Afrika-Institut
Zwei Wochen lang haben sich insgesamt 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bundesgebiet sowie aus dem Ausland, die ganz unterschiedlichen Altersgruppen angehörten, mit der japanischen Sprache und verschiedenen Aspekten der japanischen Kultur beschäftigt. Unterrichtsschwerpunkte waren Konversation, Grammatik und Schriftzeichen. Darüber hinaus gab es ergänzende Vorträge zu japanischer Literatur und Theater, zu Aspekten der japanischen Sprache und zur Wirtschaft Japans.
Der Kurs wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde (DGA) durchgeführt.
3. Juni 2013, 18 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1,Hauptgebäude, Hörsaal K
Eine neue Energiepolitik? Fukushima und die politischen Folgen
Paul Kevenhörster, Universität Münster
 Die Dreifach-Katastrophe von Fukushima zeigt die Politik Japans in einer tiefen Krise. Die Hoffnung auf einen Neuanfang des Parteisystems wie der Politik selbst wurde bisher verspielt. Es stellt sich die Frage: Verweigert sich die politische Klasse einem politischen Neubeginn, den die Mehrheit der Bevölkerung fordert?
Die Dreifach-Katastrophe von Fukushima zeigt die Politik Japans in einer tiefen Krise. Die Hoffnung auf einen Neuanfang des Parteisystems wie der Politik selbst wurde bisher verspielt. Es stellt sich die Frage: Verweigert sich die politische Klasse einem politischen Neubeginn, den die Mehrheit der Bevölkerung fordert?
Die Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Reaktoren stößt auf Sympathie der alten und neuen Parlamentsmehrheit wie der Bürokratie, aber auf den Widerstand der Protestinitiativen, die sich des Wohlwollens der Bevölkerung erfreuen. Das „Atomare Dorf“ befindet sich auf der Anklagebank. Kann Japan sich neu ordnen – durch Einsparungen, Effizienz, erneuerbare Energien und einen bestmöglichen Energiemix?
Prof. Dr. Paul Kevenhörster lehrt Politikwissenschaft an der Universität Münster. Seine Schwerpunkte sind Internationale Entwicklungspolitik und Ostasien. Ausgewählte Publikationen:
Japan. Wirtschaft – Gesellschaft – Politik (mit Werner Pascha und Karen Shire), Wiesbaden: VS Verlag, 2010 (2. Aufl.).
Japans umfassende Sicherheit (mit Dirk Nabers), Hamburg: Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, 2003 (Nr. 364).
Japans Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand: Wegmarkierungen und Weichenstellungen, in: Chiavacci, David und Iris Wieczorek (Hg.): Japan 2008. Poltitik, Wirtschaft und Gesellschaft, Berlin: Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Japanforschung, 2008, S. 125–140.
31. Mai 2013, 14-15:30 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal H
Einführung in die Virtuelle Fachbibliothek Ost- und Südostasien CrossAsia (Schwerpunkt: Japan ) mit ihren Modulen und Datenbanken
Ursula Flache, Staatsbibliothek zu Berlin, Fachreferentin für Japan
18. Mai 2013, 13-20 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1,Ost
Japanischer Kulturtag 2013
6. Mai 2013, 18-20 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1,Ost, Raum 221
Fukushima leben" oder Heimat als Konstruktion. Die Katastrophenliteratur von Wagô Ryôichi und Yû Miri
Kristina Iwata-Weickgenannt
29. April 2013, 18 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1,Ost, Raum 221
Revitalisierung der Tohoku Region vor und nach dem 11. März 2011
Stephanie Assmann, Akita Universität, Japan
Die Tohoku Region im Norden Japans wurde von den tragischen Ereignissen des 11. März 2011 schwer getroffen. Aber bereits vor dem Unglück wurde Tohoku angesichts der Überalterung der Bevölkerung, niedriger Geburtenraten, der Abwanderung junger Bevölkerungsschichten in die Ballungsräume Tokios und Osakas und des Niedergangs der Landwirtschaft als strukturschwache Region problematisiert. Dieser Vortrag untersucht die Folgen der Dreifachkatastrophe aus der Sicht von Regierungsinitiativen und NGOs, die die Region durch Tourismus in Verbindung mit regionaler Esskultur wiederzubeleben versuchen.
Die bekannteste Tourismusinitiative auf nationaler Ebene ist die Initiative Japan. Endless Discovery, deren Ziel es ist, ausländische Besucher nach Japan zu bringen. Initiativen zur Revitalisierung sind auch auf regionaler Ebene zu beobachten. In Kooperation mit Landwirten und Kurhotels stärkt die Präfekturregierung Miyagi regionalen Gemüseanbau. Sechs Gemüsearten, darunter die Sendai Naganasu, eine längliche Auberginenart, sind als schützenswerte Kulinarien gelistet. Des Weiteren hat die Tourismuszentrale von Tohoku nach dem 11. März 2011 eine einjährige Kampagne initiiert, mit dem Ziel, inländischen Tourismus wiederzubeleben.
Aber sind Initiativen dieser Art ein geeignetes Mittel zur Sanierung der Region, die nicht nur an den schweren Folgen der Dreifachkatastrophe und der Stigmatisierung ihrer Agrarerzeugnisse leidet, sondern sich auch von einem Verfall der Landwirtschaft und einer potentiellen Öffnung des Agrarmarktes für den Freihandel bedroht sieht? Auf der Grundlage von Interviews mit Organisatoren von Tourismusinitiativen und Landwirten geht dieser Vortrag der Frage nach, ob der 11. März 2011, der eine beispiellose Zäsur darstellt, als Katalysator des Niedergangs der Region wirkt oder auch als Chance für einen Neuanfang angesehen werden kann.
Dr. Stephanie Aßmann promovierte 2003 am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg mit der Arbeit Wertewandel und soziale Schichtung in Japan. Differenzierungsprozesse im Konsumentenverhalten japanischer Frauen (Hamburg, Institut für Asienkunde, 2005). Seit 2006 arbeitet sie zu Esskultur und Ernährung und ist Mitherausgeberin von Japanese Foodways. Past and Present (herausgegeben mit Eric C. Rath, Champaign, University of Illinois Press, 2010). Sie ist an der Universität Akita tätig und lebt seit acht Jahren in der Tohoku Region.
Sommersemester 2013
Numata-Gastprofessur für Buddhismuskunde

Die Numata-Gastprofessur für Buddhismuskunde wird im Sommersemester 2013 mit Herrn Dr. Steffen Döll besetzt. Steffen Döll studierte Japanologie, Sinologie und Religionswissenschaft in München und Kyôto. Derzeit ist er wissenschaftlicher Assistent am Japan-Zentrum der LMU München und Mitglied des Jungen Kollegs der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Seine Arbeiten konzentrieren sich auf die Geistesgeschichte Japans, Systematik und Geschichte des Buddhismus sowie Kulturtransfers in Ostasien. Zusammengeführt finden sich diese Gebiete in seiner 2010 veröffentlichten Dissertation Im Osten des Meeres. Chinesische Emigrantenmönche und die frühen Institutionen des japanischen Zen-Buddhismus (2010). Er wird zwei Kurse unterrichten, von denen einer das Thema der Karmalehre des Buddhismus und der andere die Geschichte und Geschichtsschreibung des Zen-Buddhismus zum Thema hat. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir ihn im Sommersemester für Hamburg gewinnen konnten.
17. Januar 2013, 18 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude, Hörsaal H
Vortrag zum Thema „Der Buddhismus in der japanischen Literatur“ Prof. Dr. Peter Pörtner (LMU München)
Die japanische Literatur wurde von ihren Anfängen an entscheidend vom Buddhismus geformt. Kaum ein literarisches Genre, in dem sich keine Spuren der buddhistischen Weltdeutung finden. Der Vortrag versucht nachzuzeichnen, wie der Buddhismus der japanischen Literatur ihr spezifisches „Gepräge“ gegeben hat.
Prof. Dr. Peter Pörtner ist seit 1992 Professor für Japanologie an der LMU München und langjähriger Leiter des dortigen „Japan-Zentrums“. Innerhalb seiner Forschungschwerpunkte Geistesgeschichte und Gesellschaft Japans hat er sich immer wieder mit Fragen der Ästhetik und der Literatur beschäftigt. Zu seinen einflußreichsten und bekanntesten Publikationen zählen die Studie zu und Übersetzung von Nishida Kitarôs Zen no kenkyû („Über das Gute“) sowie die Philosophie Japans (Kröner, zusammen mit J. Heise), daneben zahlreiche Aufsätze zu geistesgeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen.
14. Januar 2013, 18 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude, Hörsaal C
Das Innovationspotential ungleicher Partnerschaften: Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft in Japan
Susanne Brucksch (Freie Universität Berlin)
In Japan ist seit den 1990er Jahren ein Zuwachs von Kooperationen zwischen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Umweltorganisationen unübersehbar: also im klassischen Spannungsfeld zwischen ökonomischen Interessen und ökologischen Ansprüchen. Doch welches Gestaltungspotential erwächst auf der anderen Seite daraus? Im Vortrag werden Umweltkooperationen als eine neue Form sozialer Teilhabe verstanden, die im vorpolitischen Raum innovative und selbständige Antworten auf ökologische Probleme suchen. Trotzdem sind dem hier umrissenen Engagement ebenfalls Grenzen gesetzt, welche beispielsweise aus dem ungleichen Kräfteverhältnis zwischen Umweltorganisationen und Unternehmen in Japan resultieren. Um die Frage nach dem Innovationspotential partnerschaftlicher Problemlösungsansätze zu beantworten, greift der Vortrag u.a. auf die Ergebnisse einer quantitativen Datenerhebung und einer qualitativen Fallbeispieluntersuchung zurück. Dr. Susanne Brucksch arbeitet seit 2009 am Institut für Ostasienstudien an der Freien Universität Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Umwelt-, Energie- und Technologiepolitik, Zivilgesellschaft, CSR und Unternehmen in Japan. Vorher war sie unter anderem am DIJ in Tokyo, der Senshu University, dem Umweltbundesamt in Dessau und dem IGK Bürgergesellschaft, Halle-Tokyo tätig. Ihr Buch über „Ungleiche Partner, gleiche Interessen? Kooperationen zwischen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Umweltorganisationen in Japan“ ist 2011 im Iudicium Verlag (DIJ Monografien Band 47) erschienen. Darin geht Susanne Brucksch vornehmlich folgenden zwei Fragen nach: Welches umweltpolitische Gestaltungspotential entsteht aus dem deutlichen Zuwachs transsektoraler Partnerschaften seit den 1990er Jahren? Und, wie wirkt sich das ungleiche Machtverhältnis zwischen den Akteuren auf die Zusammenarbeit aus?
Veranstaltungen 2012
3. Dezember 2012 18 Uhr c.t.
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude, Hörsaal C
Eine „Anti-Atom-Bewegung“ in Japan? Thematische Ausrichtung und Strukturelle Hindernisse
Tadahisa Izeki (Chūō Universität, Tokyo)
Seit der Atomkatastrophe von Fukushima wächst Japans Anti-Atom-Bewegung. Im Juli 2012 wurde die Grüne Partei Japans (Nihon Midori no tō) gegründet – eine erste direkte Reaktion seitens der Politik auf diese in ihrer Dimension neuen Bürgerproteste. Häufig werden im Kontext der japanischen Anti-Atom-Bewegung die folgenden beiden Fragen gestellt: Warum gibt es in Japan trotz der Erfahrungen von Hiroshima und Nagasaki so viele Atomkraftwerke? Und warum hat sich die japanische Anti-Atom-Bewegung bisher politisch derart im Hintergrund gehalten? Um diese Fragen zu beantworten, werden im Vortrag die Entstehungsgeschichte der Protestbewegung sowie die strukturellen Dimensionen von Japans Atompolitik näher betrachtet.
Prof. Dr. Tadahisa Izeki arbeitet seit 2004 an der Chūō Universität (Tokyo) und ist derzeit Gastwissenschaftler am GIGA-IAS (Hamburg). Zuvor war er bei DESK (Zentrum für Deutschland- und Europastudien, Komaba) der University Tokyo beschäftigt. 1999 promovierte er an der Freien Universität Berlin zum Thema „Das Erbe der Runden Tische in Ostdeutschland: Bürgerorientierte Foren in und nach der Wendezeit“ (Peter Lang, 1999). Professor Izeki forscht vordergründig über die 1960er Jahre. Zu diesem Thema ist er beispielsweise Mitautor des Buches The Transborder Sixties: the USA, Japan and Europe (Sairyūsha, 2012) sowie Autor des Buches Doitsu wo kaeta 68nen undō (Hakusuisha, 2005).
22. November 2012 18 Uhr c.t.
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, Hörsaal 221
Ottoman-Japanese Relations as the Site of Informal Diplomacy, Intelligence and the Transnational in Eurasia, Vortrag(englisch)
Prof. Dr. Selçuk Esenbel (Istanbul)
Ottoman-Japanese Relations during the nineteenth century emerged from the shared interest of both polities to incorporate sufficient degree of modern Western civilization for selfstrengthening in order to counter the domination of the West. Divergent interests determined the attitude of the Ottoman and Japanese empires. The Ottoman Turkish perspective saw Japan as a rising star of the East that was successful in the reforms of the Meiji era and had achieved the goal of selfstrengthening. The Ottoman ruler Abdulhamid II also desired to form a close relationship with the hope to find a special partner in an Asia-oriented diplomacy toward the world of Islam as a challenge to the British and Dutch colonial powers with large Asian Muslim populations. Japanese diplomats saw the Ottoman realm as the site for the investigation of rivalry between Russia and Britain and the problematic of the unequal treaties. The Japanese military incorporated the Ottoman territories into the Asian intelligence network against Russia. The Japanese Pan-Asianists gazed at the Ottoman empire as the gateway to partnership with the transnational of the Pan-Islamist actors in Asia. The Ottoman empire served as the site of informal diplomacy, intelligence, and the transnational connections for Japanese engagement. Hence, Ottoman-Japanese relations reveal an alternative form of “international relations” based on the informal and the transnational that was interstate and in-terregional. This twilight zone of international relations took place parallel to formal treatybased relations, which have been the main focus of historical analysis, thereby expanding our understanding of the global processes in interstate and international relations.
Prof. Dr. Selçuk Esenbel lehrt an der Boğaziçi Universität in Istanbul. Sie studierte in Japan und den USA japanische Geschichte und Sprache. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen japanischer Geschichte, Peasant Studies, Historiographie sowie im Bereich asiatischer Zivilisationen.
In Kooperation mit dem TürkeiEuropaZentrum.
26. September 2012, 18 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, West, Raum 221
Frau Prof. Dr. Hijiya-Kirschnereit ist eine herausragende Vertreterin der Japanologie in Deutschland und darüber hinaus. Sie lehrt seit 1991 – unterbrochen von ihrer Tätigkeit als Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio 1996 bis 2004 – bis heute an der FU Berlin und gehörte 1993 zu den Gründungsmitgliedern der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie erhielt 1992 die wichtigste wissenschaftliche Auszeichnung in Deutschland, den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis und 2001 den Eugen-und-Ilse-Seibold-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Auch im gesamteuropäischen Raum machte sie sich als Präsidentin der European Association for Japanese Studies (1994 bis 1997) einen Namen.
In ihrem bebilderten Vortrag geht es um den Einzug von Sushi in unsere Alltagskultur und um das Einheimischwerden von Baumkuchen in Japan. Die Assimilation von Sushi, das mittlerweile zum globalen Symbol für japanische Küche und Lebensart avancierte, bietet ebenso wie die japanischen Verfeinerungen des dort wohl beliebtesten Gebäcks Gelegenheit zum Spaziergang durch die moderne Geschichte, zum Nachdenken über nationale Identitäten und zum kurzweiligen Blick auf Kurioses und Erhellendes im Verhältnis der Nationen.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung und bitten Sie um Anmeldung bei
Deutsch-Japanische Gesellschaft zu Hamburg e. V. Hartungstr. 14
D - 20146 Hamburg
Telefon: +49 40 2880 3620
Telefax: +49 40 2880 3621
e-Mail: djg@hashimaru.de
17. September 2012
Besuch von Studierenden der Meiji Gakuin University
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 120
Im Rahmen einer Studienreise besuchten 20 Studierende der Meiji Gakuin Universität am 17. September 2012 unter der Leitung von Prof. Dr. Shinji Iwanaga das Asien-Afrika-Institut. Die japanischen Gäste wurden von den Studierenden der Japanologie Hamburg empfangen. Zu den Erlebnissen des gemeinsamen Workshops am Vormittag zählten Präsentationen seitens der japanischen Studierenden zu verschiedensten Themen der japanischen Kultur, wie etwa Kunsthandwerk und Kleidung. Im Anschluss an eine gemeinsame Mittagspause nahmen die Hamburger Studierenden die Gäste mit auf einen Stadtspaziergang, der vom Rathaus über den Michel bis hin zu den Landungsbrücken quer durch Hamburg führte. Nach einigen Kilometern Fußweg, vielen Eindrücken aus der Stadt und einem intensivem kulturellen Austausch zwischen deutschen und japanischen Studierenden klang der Tag in entspannter Atmosphäre beim Abendessen in einem deutschen Brauhaus aus.
16.-28. Juli 2012 Intensivkurs Japanisch
Ort: Asien-Afrika-Institut
Der Intensivkurs Japanisch fand auch in diesem Sommer in zwei Stufen (I / Anfänger ohne Vorkenntnisse und III / Anfänger mit guten Vorkenntnissen) statt.
Innerhalb der zwei Wochen haben sich die Teilnehmer, die sich für verschiedene Aspekte Japans interessieren und unterschiedlichen Altersgruppen angehören, mit der japanischen Sprache (Konversation und Grammatik sowie Schriftzeichen) und darüber hinaus auch mit verschiedenen Aspekten der japanischen Kultur beschäftigt.
Der Kurs wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde (DGA) durchgeführt.
2. Juli 2012, 18:15
Ort: Asien-Afrika-Institut, Raum 221
Mediale Konstruktion Okinawas - postkolonial betrachtet
Ina Hein (Universität Wien)
Seit Mitte der 1990er Jahre ein regelrechter „Okinawa-Boom“ die japanische Populärkultur erfasste, wird Okinawa, die südlichste und jüngste japanische Präfektur, insbesondere in Kinofilm und Fernsehserien (terebi dorama) als exotisches, friedliches Inselparadies vermarktet, das seinen japanischen BesucherInnen iyashi – bzw. Heilung von den negative Einflüssen der japanischen Moderne – verspricht. Die Probleme Okinawas und seine konflikthafte Beziehung zu den japanischen Hauptinseln, die auf die Erfahrungen der verlustreichen Schlacht von Okinawa, der darauf folgenden langen amerikanischen Besatzungszeit und der bis heute weiterhin anhaltenden, starken militärischen Präsenz vor Ort zurückgehen, werden dagegen konsequent ignoriert. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen nun Konstruktionen Okinawas aus okinawanischer Perspektive, in denen sich eine dezidiert kritische Haltung gegenüber diesen populären, stereotypen Bildern von Okinawa ausdrückt. Ausgewählte Kinofilme und Fernsehproduktionen werden insbesondere unter der Frage diskutiert, welche (andernorts ausgeblendet bleibenden) Themen darin behandelt werden und welche narrativen Modi Anwendung finden. Werden bestimmte Erzählstrategien verfolgt, um Widerstand gegen die von den japanischen Mainstream-Medien verbreiteten Okinawa-Bilder auszudrücken – und (wie) lassen sich diese im Rahmen postkolonialer Theorie erfassen?
Die Referentin ist seit 2010 Professorin für Japanologie mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien. Zuvor war sie wissenschaftliche Angestellte im Institut für Modernes Japan an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihre Dissertation entstand an der Universität Trier im Rahmen eines DFG-Graduiertenkollegs und erschien 2008 unter dem Titel Under Construction. Geschlechterbeziehungen in der Literatur populärer japanischer Gegenwartsautorinnen. Aktuell bezieht sich ihre Forschung auf Diskurse um kulturelle Differenz(en) im gegenwärtigen Japan.
Die Veranstaltung erfährt Unterstützung aus dem Frauenförderfonds der Universität Hamburg 2012. Eingeworben von Ruth Achenbach, M.A. für das Modul [OA-V3] Politik und Gesellschaft Japans.
1. Juli 2012
Ort: Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg
JLPT - Japanese Language Proficiency Test
Der "Japanese Language Proficiency Test" (JLPT) findet dieses Jahr in der Hamburger Japanologie am 01.07.2012 statt. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 04. 04. 2012 möglich. Das Anmeldeformular kann im Geschäftszimmer der Japanologie (Raum 104) abgeholt oder per Mail (jlpt [at] uni-hamburg.de) angefordert werden.
12. Juni 2012, 18:15
Ort: Asien-Afrika-Institut, Raum 221
MAKING TEA, MAKING JAPAN: CULTURAL NATIONALISM IN PRACTICE
Kristin Surak (University of Duisburg-Essen)
The tea ceremony is one of the most evocative symbols of Japan, conjuring up images of kimono-clad women whisking up the beverage by means of an esoteric ritual. But why is this the case when just two hundred years ago elite warriors were the ones learning its arcane procedures? More generally, how does a cultural practice of a few come to represent a nation as a whole? Few have peered behind the rustic walls of a tea room to dissect the interplay of elegance and austerity that has been carried by both elite warriors and common housewives, and is colored by an ideology of simplicity now managed and sold by large corporations. But a closer look at these tensions provides insights into how cultural practices can be used to crystallize the essence of a nation, not only during its birth-pangs, but also afterward, when it becomes a mundane feature of the world. This tour of tea rituals past and present provides insight into one of the fundamental processes of modernity, the work of making nations.
Kristin Surak is an Assistant Professor of Comparative Sociology at the University of Duisburg-Essen specializing in international migration, culture, ethnicity, and nationalism. Prior to her arrival in Germany, she was a Robert and Lisa Sainsbury Fellow at SOAS, University of London, and a Max Weber Fellow at the European University Institute. Her forthcoming book, Making Tea, Making Japan: Cultural Nationalism in Practice (Stanford University Press 2012), examines the relationship between cultural practices and national meanings by investigating how the tea ceremony is produced and sustained as distinctively Japanese. Her articles have appeared in the European Journal of Sociology, International Migration Review, Ethnic and Racial Studies, Lettre International, and the New Left Review.
8. Juni, 10.15–11.45 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut, Raum 221
Vortrag von Prof. Dr. Eduard Klopfenstein (Zürich)
„Über Beziehungen zwischen den Geschlechtern und den Begriff ,Ai‘ in der japanischen Literatur“
Ausgehend von einem Gedicht von Ayukawa Nobuo (1920–1986) wird der Vortragende einige Betrachtungen anstellen über Rationalität und Emotionalität in den (mehr oder weniger) andauernden Beziehungen zwischen Mann und Frau. Es soll dabei vor allem um die gesellschaftliche Entwicklung von der vormodernen Zeit über die Meiji-Zeit bis zur Zeit nach dem 2. Weltkrieg gehen, d.h. bis und zur Übernahme des westlichen Konzepts der „Liebe“. Das Thema wird auch in dem Essay von Tanizaki Jun'ichirô „Liebe und Sinnlichkeit“ (Übersetzung: Eduard Klopfenstein, Manesse Verlag 2011) aufgegriffen.
Prof. Dr. Eduard Klopfenstein ist Emeritus der Japanologie des Ostasiatisches Seminars der Universität Zürich. Nach der Promotion 1968 (Germanistik) studierte er zwischen 1964–1966 an der Universität Kyôto. 1979 Habilitation in Japanologie. 1989 Ernennung zum Ordinarius. Zahlreiche Forschungsaufenthalte in Japan. 1996–2003 Präsident der Schweizerischen Asiengesellschaft. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Moderne und Gegenwartsliteratur, insbesondere Lyrik der Gegenwart. Verantwortlicher Herausgeber für den deutschen Sprachraum im Rahmen des „Japanese Literature Publishing Project“ (JLPP). 2010 Auszeichnung mit dem Orden „Order of the Rising Sun“.
08. Juni 2012, 14.00 Uhr, ESA-Ost 221
Wege nach Japan – Infoveranstaltung
Noriyoshi Masuko und Renate von Bülow (beide: Botschaft von Japan, Berlin) stellen Austauschprogramme nach Japan und mögliche Stipendien der japanischen Regierung vor.
Im Anschluss daran berichtet Jana Spychalski (Universität Hamburg) von ihrer Studienreise nach Tōhoku im März 2012 – auch dies ein Austauschprogramm der japanischen Regierung.
22. Mai 2012, 19.00-21.00
Ort: Asien-Afrika-Institut, Raum 221
„Mit den Sternen nächtlich im Gespräch …“: Moderne japanische Haiku
Lesung mit Sandra Flubacher (Thalia-Theater)
Mit dem modernen Haiku zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte die kleinste poetische Gattung der Welt„ auch in Japan ihren eigentlichen Durchbruch. Zumeist mit den Mitteln der Gegenwartssprache, widmen sich die Dichter und Dichterinnen neben Naturphänomenen nun Themen wie der Arbeitswelt, der Politik oder Kriegserfahrungen, sie reflektieren persönliches Leiden und Freude auf vielfältige und neue Weise. Damit erlauben diese Gedichte einen überraschenden Blick auf die Menschen und ihren Alltag während einer der spannendsten Epochen in der Geschichte Japans, die Modernisierung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Aus Anlaß des Erscheinens einer Anthologie, die sich erstmals in deutscher Sprache ganz auf diese Epoche konzentriert („Mit den Sternen nächtlich im Gespräch“: Moderne japanische Haiku; übersetzt von Oscar Benl, Géza S. Dombrady und Roland Schneider, Ostasien Verlag 2011), sollen in einer Lesung ausgewählte Beispiele Japanisch und Deutsch „zu Gehör“ gebracht werden. Ein einführender Kommentar verdeutlicht die Entstehungsumstände und Besonderheiten dieser Dichtung.
Der Eintritt ist frei.
Konzeption und Einführung: Prof. Dr. Jörg B. Quenzer (Japanologie, Universität Hamburg)
17. Mai 2012: Japanischer Kulturtag 2012
Ort: Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg
Weitere Informationen unter:
Programm Flyer
17. Mai 2012: Radioactivists - Protest in Japan seit Fukushima
Filmvorführung in Anwesenheit der Regisseurinnen im Rahmen des Japan-Kulturtages
Ort: Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg
ab 18 Uhr, Raum: ESA-O 221
Trailer: http://radioactivists.org/de/
Seit der Katastrophe am 11. März erlebt Japan gesellschaftspolitische Erschütterungen von historischer Bedeutung. Besonders in Tokio entfacht ein Protest, der sich vor allem gegen die Regierung, Atomaufsichtsbehörde und den Energiekonzern TEPCO richtet. Straßenproteste galten hier bisher als seltener Anblick. Eine Protestkultur ist im Japan der „nuller“ Jahre quasi nicht existent. Eine Ausnahme bildet lediglich die Gruppe kreativer Aktivisten des Shirōto no ran, dem „Aufstand der Amateure“. In dem alternativen Viertel Kōenji treten sie für mehr Freiheit im öffentlichen Raum Tokios sowie eine einfallsreiche Do It Yourself-Kultur ein. Die Aktivisten um Shirōto no ran o rganisierten am 10. April, knapp einen Monat nach der Katastrophe, die größte Demonstration in Japan seit den 1970er Jahren. Mehr als 15.000 Teilnehmer demonstrierten an diesem Tag gegen Atomkraft. Dabei geht es den meisten Aktivisten der japanischen Anti-Atom-Demos um mehr als den Atomausstieg. Sie wollen auch auf die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen sowie die fehlenden Freiräume für ihre persönliche Entfaltung aufmerksam machen. Der Dokumentarfilm Radioactivists – Protest in Japan seit Fukushima setzt an dieser Stelle an, begleitet die Protestbewegung, zeigt die Hintergünde auf und lässt die kritischen Stimmen zu Wort kommen, die – nicht nur in Japan – immer lauter werden.
RADIOACTIVISTS – Protest in Japan since Fukushima
Germany/Japan 2011, 72 min.
Directed & Produced by: Julia Leser & Clarissa Seidel
Editor: Clarissa Seidel
Additional Photography: Arseny Rossikhin
Associate Producers: Roger Zehnder, Yoshihiro Akai
Graphic Design: Clemens Berger & René Hänsel
Original Music: Junsuke Kondo, We Want Wine, ECD
Translation: Yasuo Akai
Featuring: Yoshihiko Ikegami, Chigaya Kinoshita, Hajime Matsumoto, Keisuke Narita, Yoshitaka Mori, Human Recovery Project
14. Mai 2012, 18.00-20.00
Ort: Asien-Afrika-Institut, Raum 221
Brian Daizen Victoria (Antioch University): “D.T. Suzuki, Zen and the Nazis”
In recent years the role of Japan's leading Zen masters as supporters of Japanese militarism during WWII has been established beyond a doubt. However, D.T. Suzuki's wartime role remains a subject of great, and sometimes heated, controversy. This is true despite the fact that one of Suzuki's wartime editors, Handa Shin, wrote in 1941: “Dr Suzuki's writings are said to have strongly influenced the military spirit of Nazi Germany.” But is this true?
This lecture seeks to answer this question beginning with the first American to make direct contact with D.T. Suzuki in postwar, occupied Japan, i.e., Albert Stunkard. Stunkard mentioned briefly, that Suzuki stood in close contact with a German named Graf Dürckheim, who had been imprisoned as a suspected war criminal. I wondered why a suspected German war criminal had been studying with D.T. Suzuki during WW II? The purpose of this lecture is therefore to share the “discoveries” made in the process of researching this question and the larger question of Nazi interest in Zen and Buddhism.
Japanisch-Intensivkurs Kanji 13.02.-24.02.2012
Der diesjährige Intensivkurs im Frühjahr konzentrierte sich auf die japanischen Schriftzeichen. Innerhalb zwei Wochen lernten 67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 1006 Kyôiku-Kanji (Grundschul-Kanji) nach einem neuen Lernkonzept.
Der nächste Intensivkurs ist für Juli dieses Jahres geplant. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde (DGA) werden Japanisch-Sprachkurse in vier Stufen angeboten.
23. Februar 2012, 14:00 - 15:30
Ort: AAI, Raum 221
Vorträge im Rahmen des Intensivkurses Japanisch - Kanji
Prof. Dr. Jörg B.Quenzer (Abteilung für Sprache und Kultur Japans) "Schrift und Bild in Japan"
Jörg B. Quenzer vertritt den Schwerpunkt Literaturwissenschaft, Geistes- und Kulturgeschichte an der Abt. für Sprache und Kultur Japans des AAI. Darüber hinaus ist er aktiv im aktuellen Sonderforschungsbereich 950 an der Universität Hamburg, der sich mit Manuskriptkulturen in aller Welt beschäftigt.
Auch Studierende, die für den Intensivkurs nicht angemeldet sind, sind dazu herzlich eingeladen!
14. Februar 2012, 14:00 - 15:30
Ort: AAI, Raum 221
Vorträge im Rahmen des Intensivkurses Japanisch - Kanji
Prof. Dr. Hans Stumpfeldt (Emeritus Abteilung für Sprache und Kultur Chinas)
"Entstehung und historische Entwicklung der chinesischen Schriftzeichen"
Hans Stumpfeldt ist Emeritus der Abt. für Sprache und Kultur Chinas am Asien-Afrika-Institut (AAI). Seit Jahrzehnten vermittelt er in Vorträgen und Veröffentlichungen Kulturgeschichtliches zu China von der Han-Zeit (206 vor bis 220 nach Christus) bis zur Gegenwart.
Auch Studierende, die für den Intensivkurs nicht angemeldet sind, sind dazu herzlich eingeladen!
24 January 2012 14.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Ort: Gebäude der Finanzbehörde, Leo-Lippmann-Saal
Gänsemarkt 36, in 20354 Hamburg
"Glück in Japan" - Aspekte interkultureller Werteforschung,
Prof. Dr. Florian Coulmas, Direktor, Deutsches Institut für Japanstudien (DIJ), Tokyo
 Die Frage nach dem Glück ist heute eine Frage, die in hoch entwickelten Industriegesellschaften gestellt wird. Zweifel an den Glücksverheißungen des Kapitalismus sind aufgekommen. Systemvergleiche—das liberalistische angelsächsische Modell, das sozialdemokratische europäische Modell, das konsensualistische industriepolitsche Modell Japans—sind zum integralen Bestandteil der Suche nach dem rechten Weg für die Verwirklichung des Prinzips „des größten Glücks für die größte Zahl“ geworden. Als erstes und erfolgreichstes nicht-weißes, nicht-christliches und nicht-westliches Industrieland ist Japan in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse. Hinzukommt, dass die kulturelle Einbettung von Glücksvorstellungen als konterkarierende Kraft der gerade in unserer heutigen Zeit besonders stark erscheinenden homogenisierenden Tendenzen der Globalisierung wirken könnte. Sowohl in Japan als auch in der BRD haben die Regierungen Enquete-Kommissionen eingesetzt, die Antworten auf die Frage geben sollen, was dem Glück der Bürger förderlich ist. In diesem Vortrag wird erläutert, wie aus Sicht der Wissenschaft mit dieser Frage umgegangen wird, die in immer mehr Disziplinen Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Die Frage nach dem Glück ist heute eine Frage, die in hoch entwickelten Industriegesellschaften gestellt wird. Zweifel an den Glücksverheißungen des Kapitalismus sind aufgekommen. Systemvergleiche—das liberalistische angelsächsische Modell, das sozialdemokratische europäische Modell, das konsensualistische industriepolitsche Modell Japans—sind zum integralen Bestandteil der Suche nach dem rechten Weg für die Verwirklichung des Prinzips „des größten Glücks für die größte Zahl“ geworden. Als erstes und erfolgreichstes nicht-weißes, nicht-christliches und nicht-westliches Industrieland ist Japan in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse. Hinzukommt, dass die kulturelle Einbettung von Glücksvorstellungen als konterkarierende Kraft der gerade in unserer heutigen Zeit besonders stark erscheinenden homogenisierenden Tendenzen der Globalisierung wirken könnte. Sowohl in Japan als auch in der BRD haben die Regierungen Enquete-Kommissionen eingesetzt, die Antworten auf die Frage geben sollen, was dem Glück der Bürger förderlich ist. In diesem Vortrag wird erläutert, wie aus Sicht der Wissenschaft mit dieser Frage umgegangen wird, die in immer mehr Disziplinen Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Der Referent ist seit 2004 Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien (DIJ) in Tokyo. Er war als Professor für Soziolinguistik an der Chūō-Universität in Tokyo tätig, ebenso an der Universität Duisburg-Essen im Fachbereich Sprache und Kultur des modernen Japan. Zu seinen neuesten Publikationen zählen die folgenden Bücher: Fukushima. Vom Erdbeben zur atomaren Katastrophe (mit Judith Stalpers, 2011, C.H. Beck), Die 101 wichtigsten Fragen: Japan (mit Judith Stalpers, 2011, C.H. Beck), Hiroshima. Geschichte und Nachgeschichte (2010, C.H. Beck), Die Illusion vom Glück. Japan und der Westen (2009, Verlag Neue Zürcher Zeitung) und Population Decline and Ageing in Japan – The Social Consequences (2007, Routledge).

Freie und Hansestadt Hamburg, Landeszentrale für politische Bildung und Japanisches Generalkonsulat Hamburg und Universität Hamburg.
20 January 2012 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut, Raum 221
Einführung in CrossAsia, Schwerpunkt: Japan Virtuelle Fachbibliothek Ost- und Südostasien
Ursula Flache, Fachreferentin für Japan an der Staatsbibliothek zu Berlin, stellt die dortige Ostasienabteilung mit ihren überregionalen Dienstleistungen wie dem "Blauen Leihverkehr" sowie die Virtuelle Fachbibliothek Ost- und Südostasien CrossAsia vor.
Zun/auml;chst wird ein Überblick über die einzelnen Funktionen von CrossAsia gegeben:
Metasuche über diverse Bibliothekskataloge
Fachinformationsführer Online Guide East Asia (OGEA)
Digitale Sammlungen
CrossAsia Diskussionsforum
Datenbanken in ostasiatischen Sprachen (frei zugängliche sowie lizenzpflichtige)
CrossAsia Campus
Im zweiten Teil werden vier lizenzpflichtige japanische Datenbanken mit ihren Inhalten und Suchmöglichkeiten vorgestellt:
Kikuzou II bijuaru for libraries (Asahi Shinbun, Volltext)
CiNii Articles (Zeitschriftenartikel, teilweise Volltextzugriff)
Japan Knowledge (Online-Plattform für diverse Nachschlagewerke)
WhoPlus (bio- bibliographische Informationen)
11. Januar 2012 von 14.00-18.00
Manga-Übersetzungsworkshop
mit Herrn Jürgen Seebeck, Übersetzer von u.a. "Akira" und "Dragon Ball"
Am 11. Januar 2012 von 14.00-18.00 wird ein Workshop in Zusammenarbeit mit dem Japanischen Generalkonsulat veranstaltet. Im Vordergrund stehen hier nicht das künstlerische und kreative Zeichnen von Mangas, sondern es geht um die Textpassagen japanischer Mangas, die ins Deutsche übersetzt werden. Darum sind Voraussetzungen für die Teilnahme am Workshop adäquate Japanisch-Kenntnisse. Mit dem Workshop soll den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, einen weiteren Teil der Mangawelt zu erkunden und diese mit Zeichnen und Sprache abzurunden.
Anmeldung wird erbeten bei AGORA unter dem Kurstitel "übersetzungsworkshop Japanisch" oder an: Frau Dr. Sugihara (saki.sugihara [at] uni-hamburg.de).
Veranstaltungen 2011
15/16 December 2011
Ort: Hamburg Chamber of Commerce
Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg
Anmeldung erforderlich!
Internationales Symposium in englischer Sprache
International Migration of Highly Skilled Workers to Japan and Germany. Current Models and Future Outlooks
Japan and Germany are both countries facing an increasing economic competition from the newly industrializing countries. Moreover, both Japan and Germany are rapidly aging societies, which due to a decline in working age population will face severe labor shortages in the all too near future. In order to keep their positions as two of the world's leading economies, they need to focus on training highly skilled personnel to match the economic structural change. Efforts in both countries to invite highly skilled migrants or to engage in advanced vocational training of migrants already residing in the country have either been few or of little success.
Questions in this realm, which need to be discussed more thoroughly and are thus raised in this symposium include the following: Which criteria do governments set for desired migration, and how do they aim at implementing these criteria? Which other actors (business federations, labor unions, nongovernmental organizations) influence the shaping of immigration - and integration - policies? How does immigration change the societal structure of the receiving countries, and how can these changes be addressed coherently? The symposium aims at contributing to the ongoing discourse on how to achieve well-directed immigration to industrialized nations.
12. Dezember 2011 18-20 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude, 20146 Hamburg, Hörsaal K
What Difference Did It Make? Japanese Policy and Politics After the Disaster
John C. Campbell (Tokyo University)
John Creighton Campbell is Professor Emeritus of Political Science at the University of Michigan and Visiting Professor in the Institute of Gerontology at Tokyo University. Among his many publications is How Policies Change: The Japanese Government and the Aging Society (Princeton University Press), winner of the 1993 Ohira Memorial Prize. In his talk, Professor Campbell will be addressing the changes in Japan's policy and politics in the wake of the multiple disasters of 3/11.
28. November 2011 18-20 Uhr
Ort: Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude, 20146 Hamburg, Hörsaal K
Das Silbermarktphänomen in Japan
Auswirkungen des demographischen Wandels auf Produktmanagement, Marketing und Werbung
Florian Kohlbacher (DIJ)
 Eine wichtige Implikation des demografischen Wandels für die Betriebswirtschaft ist das Entstehen eines so genannten „Silbermarkts“ oder „Wachstumsmarkts Alter“. In Japan machen die über 50-jährigen bereits mehr als 40% der Gesamtbevölkerung aus und die über 65-jährigen fast 25%, Tendenz steigend. Dieser demographische Wandel bringt eine Verschiebung der Marktsegmente mit sich: So steht dem – gemessen an der Anzahl junger Menschen – immer kleiner werdenden Jugendsegment ein ständig wachsendes Seniorensegment gegenüber. Dieser Silbermarkt scheint zahlreiche Geschäftschancen zu bieten, doch fehlen vielen Firmen die notwendigen Erfahrungen, die Prozesse und das Know-how, um passende Produkte zu entwickeln und diese effizient und erfolgreich zu vermarkten.
Eine wichtige Implikation des demografischen Wandels für die Betriebswirtschaft ist das Entstehen eines so genannten „Silbermarkts“ oder „Wachstumsmarkts Alter“. In Japan machen die über 50-jährigen bereits mehr als 40% der Gesamtbevölkerung aus und die über 65-jährigen fast 25%, Tendenz steigend. Dieser demographische Wandel bringt eine Verschiebung der Marktsegmente mit sich: So steht dem – gemessen an der Anzahl junger Menschen – immer kleiner werdenden Jugendsegment ein ständig wachsendes Seniorensegment gegenüber. Dieser Silbermarkt scheint zahlreiche Geschäftschancen zu bieten, doch fehlen vielen Firmen die notwendigen Erfahrungen, die Prozesse und das Know-how, um passende Produkte zu entwickeln und diese effizient und erfolgreich zu vermarkten.
Dieser Vortrag gibt eine Einführung in des japanische „Silbermarktphänomen“ und analysiert die Herausforderungen und Chancen, die der Silbermarkt bietet. Dabei werden die die Erfolgsfaktoren für Produktentwicklung, Innovations- und Technologiemanagement sowie Marketing und Werbung anhand von theoretischen Konzepten, empirischen Daten und praktischen Beispielen erklärt. In diesem Zusammenhang werden auch unternehmerische Verantwortung und wirtschaftsethische Aspekte beleuchtet werden.
Dr. Florian Kohlbacher ist Leiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung am Deutschen Institut für Japanstudien (DIJ) Tokyo. Derzeit koordiniert er ein Forschungsprojekt zu den betriebswirtschaftlichen Implikationen des demografischen Wandels. Dr. Kohlbacher ist Fellow des World Demographic & Ageing Forum und Advisor des International Mature Marketing Network (IMMN). Er ist Autor von “International Marketing in the Network Economy: A Knowledge-Based Approach”, Palgrave, 2007, und Mitherausgeber von “The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in the Aging Society“, 2. Auflage, Springer, 2011.
18.-19. November 2011
Ort: Universität Hamburg, Flügel West
Edmund-Siemers-Allee 1, West, 20146 Hamburg, Raum 221
20 Jahre Japanisch-Deutscher Stadtteildialog
Anlässlich der 150-jährigen Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan, thematisieren wir den gegenwärtigen Kulturaustausch der beiden Länder. Wegen der tragischen Ereignisse in Japan werden wir neben einem Austausch über Gentrifi zierung aktuell die Folgen von Erdbeben, Tsunami und Atomunfall, über Möglichkeiten des bürgernahen sowie politisch und ökologisch nachhaltigen künftigen Wiederaufbaus diskutieren. Die Veranstaltungen fi nden nach dem Motto „Die Uni in die Stadt und die Stadt in die Uni“ an der Universität Hamburg und im Stadtteil Ottensen/Altona statt.
17. Oktober 2011 18-20 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Parteienpolitik und institutionelle Reformen
Ein Vergleich zur deutschen Politik
Prof. Dr. Kenji Hirashima (Universität Tokyo)
Prof. Dr. Kenji Hirashima lehrt seit 1986 am Institute of Social Science der Universität Tokyo. Er hat mehrere Forschungsaufenthalte in Deutschland absolviert, unter anderem an der Universität Konstanz (1987–1989) und am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln (1997– 1998). Er war ferner Gastwissenschaftler am East Asia Program der Cornell University in Ithaca, NY/USA (1998–1999) und an der L‘Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales in Paris (2011).
Zu seinen Forschungsinteressen gehören die vergleichende Politikwissenschaft sowie die deutsche und europäische Politik. Zusammen mit Roland Czada ist er Herausgeber von Germany and Japan after 1989. Reform Pressures and Political System Dynamics (ISS Research Series No. 33, Feb. 2009). Zu seinen zahlreichen Publikationen zählt ferner sein Aufsatz „European Integration in a Historical Perspective: How Did It Begin and What Are the Lessons for Asia?“ in Tamio Nakamura (Hg.): East Asian Regionalism from a Legal Perspective (London: Routledge).
19. September 2011
Besuch von Studierenden der Meiji Gakuin University
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 120
Im Rahmen ihrer Deutschlandreise besuchte eine Delegation von mehr als 20 Studierenden der Meiji Gakuin University, einer Partneruniversität der UHH, das Asien-Afrika-Institut am 19. September 2011. Für diesen Tag war ein abwechslungsreiches Programm zusammen mit den gastgebenden Studierenden der Japanologie in Hamburg geplant. Am Vormittag präsentierten die Gäste aus Tokyo unter der Leitung von Prof. Dr. Shinji Iwanaga sehr anschaulich die japanische Kultur. So konnten die deutschen Teilnehmer sich in Kalligraphiekünsten versuchen, eine Teezeremonie aus nächster Nähe erleben und viel über japanische Speisen, Anime und Mode in Japan erfahren.
Nach einem gemeinsamen Lunch revanchierten sich die Hamburger Gastgeber mit einem Rundgang durch die Innenstadt. Am Abend ging es kulinarisch nach Süddeutschland: in einem Hamburger Gasthaus klang der Tag im Zeichen von deutsch-japanischer Partnerschaft aus.
Ordensverleihung an Professor em. Dr. Pohl
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
11.07.2011
ab 19.30 Uhr in direktem Anschluss an die Ringvorlesung
Pressemitteilung
 Am 18. Juni 2011 wurde Herrn Prof. em. Dr. Manfred Pohl, Professor emeritus an der Abteilung für Sprache und Kultur Japans der Universität Hamburg, von Seiner Majestät Kaiser Akihito der Orden der Aufgehenden Sonne am Halsband, goldene Strahlen verliehen. Diese hohe Auszeichnung ist ein Zeichen der Wertschätzung für die verdienstvolle Arbeit, die Herr Professor Pohl im Laufe von mehr als vier Jahrzehnten zur Vertiefung der Japanstudien sowie zur Förderung des japanisch-deutschen wissenschaftlichen Austausches leistete. Von 1994 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2008 hatte Manfred Pohl als ordentlicher Professor den renommierten Lehrstuhl für Sprache und Kultur Japans am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg inne. Der designierte Generalkonsul von Japan Setsuo Kosaka wird die hohe Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde überreichen. Im Anschluss an die Zeremonie wird ein Empfang für geladene Gäste im Foyer des Asien-Afrika-Institutes stattfinden. Die Verleihungszeremonie zählt zu den Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums ‚150 Jahre Freundschaft Japan-Deutschland‘. Sie schließt sich an den Gastvortrag von Professor Dr. Hugo Dobson, University of Sheffield, im Rahmen der Ringvorlesung "Modernisierungsprozesse in Japan" an, der um 18.15 Uhr im selben Raum beginnt.
Am 18. Juni 2011 wurde Herrn Prof. em. Dr. Manfred Pohl, Professor emeritus an der Abteilung für Sprache und Kultur Japans der Universität Hamburg, von Seiner Majestät Kaiser Akihito der Orden der Aufgehenden Sonne am Halsband, goldene Strahlen verliehen. Diese hohe Auszeichnung ist ein Zeichen der Wertschätzung für die verdienstvolle Arbeit, die Herr Professor Pohl im Laufe von mehr als vier Jahrzehnten zur Vertiefung der Japanstudien sowie zur Förderung des japanisch-deutschen wissenschaftlichen Austausches leistete. Von 1994 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2008 hatte Manfred Pohl als ordentlicher Professor den renommierten Lehrstuhl für Sprache und Kultur Japans am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg inne. Der designierte Generalkonsul von Japan Setsuo Kosaka wird die hohe Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde überreichen. Im Anschluss an die Zeremonie wird ein Empfang für geladene Gäste im Foyer des Asien-Afrika-Institutes stattfinden. Die Verleihungszeremonie zählt zu den Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums ‚150 Jahre Freundschaft Japan-Deutschland‘. Sie schließt sich an den Gastvortrag von Professor Dr. Hugo Dobson, University of Sheffield, im Rahmen der Ringvorlesung "Modernisierungsprozesse in Japan" an, der um 18.15 Uhr im selben Raum beginnt.
Ringvorlesung Sommersemester 2011 Modernisierungsprozesse in Japan
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Montags, 18-20 Uhr
Termine am: 02.05., 09.05, 16.05., 06.06., 20.06., 27.06., 04.07. (19-21 Uhr!), 11.07.2011
Ausführliches Programm als pdf-Datei zum Download
Karl H. Ditze-Preis für herausragende Arbeiten in den Geisteswissenschaften
Ort: Warburg-Haus
4. Juli 2011
Die Hamburger Karl H. Ditze-Stiftung verleiht 2011 zum zehnten Mal den Karl H. Ditze-Preis für herausragende Abschlussarbeiten und Dissertationen in den Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg. Ausgezeichnet werden am 04. Juli 2011 im Warburg-Haus vier Nachwuchswissenschaftlerinnen aus den Fachbereichen Evangelische Theologie und Asien-Afrika-Wissenschaften. Darunter Ruth Achenbach, die für ihre Magisterarbeit in Japanologie mit dem Titel: "Wie viel Raum für den Juniorpartner? Eine Fallstudie der japanischen Taiwanpolitik zwischen 1969 und 1978 zur Rolle Japans Sicherheitsbündnis mit den USA" geehrt wird.
9. Juni 2011, Donnerstag, 19.00-21.00 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Sanyûtei Ryûraku: Die japanische Erzählkunst „Rakugo“ auf Deutsch (Japanisch-Deutsch)
Veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Shinwakai der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Hamburg e.V.
Rakugo, die japanische Kunst des Erzählens komisch-unterhaltsamer Geschichten, hat eine lange Tradition. Heute noch sind hunderte von Rakugo-Erzähler aktiv, die bekanntesten von ihnen zugleich als Unterhaltungskünstler im Fernsehen populär. Der Rakugo-Erzähler schlüpft während seines Vortrags in die unterschiedlichen Charaktere seiner Geschichte, wobei er durch Mimik, Gestik und Änderung der Blickrichtung unterschiedliche Gesprächspartner und Ereignisse andeutet. Die Konzentration auf das gesprochene Wort macht das Rakugo schwerer zugänglich als andere japanische Bühnenkünste. Mit der Vorführung von Meister Sanyûtei Ryûraku, der auf Japanisch und auf Deutsch vortragen wird, haben nun auch alle Interessierte, die des Japanischen nicht mächtig sind, die Gelegenheit, diese Kunstform kennen zu lernen. Sanyûtei Ryûraku (1958*) wurde 1986 Schüler des berühmten Rakugo-Meisters Sanyûtei Enraku. Seit 2008 tritt er im Ausland auf und trägt dabei Rakugo auch in der jeweiligen Landessprache vor. Dieses Jahr ist er zum ersten Mal in Deutschland zu erleben.
20. Mai 2011 (14.00-21.00 Uhr)
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221, 121, 122 und Foyer
Japanischer Kultur-Tag
Eine gemeinsame Veranstaltung des Japanischen Generalkonsulats Hamburg und der Abteilung für Sprache und Kultur Japans der Universität Hamburg.
19. Mai 2011, Donnerstag, 19.00-21.00 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Autorinnenlesung:
Lesung der japanischsprachigen Autorin Yû Miri aus Goldrush (Japanisch-Deutsch)
Die Autorin Yû Miri schildert in ihrem preisgekrönten Roman Goldrush (1998) die Abgründe jugendlicher Gewalt am Beispiel eines Jungen, der seinen Vater tötet und anschließend versucht, dessen Spielhallengeschäft zu übernehmen. Dabei werden die seelischen Bedingungen einer Generation deutlich, wie sie in jüngerer Zeit nicht nur in Japan zu beobachten ist, dort aber vielleicht noch stärker als andernorts die Brüche und Konflikte innerhalb einer modernen Gesellschaft erkennen läßt. Yû Miri (1968*), Autorin mit koreanischem Familienhintergrund, gebürtig aus Yokohama, war nach dem Abbruch der Schule zunächst als Schauspielerin aktiv, bevor sie 1988 als Schriftstellerin debütierte. Sie erhielt 1997 den bedeutenden Akutagawa-Literaturpreis.
4. Mai 2011 (16.15-17.45 Uhr)
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 124
Prinzessin und Diplomatin: Die 26. Sonderbotschafterin Hamburgs in Japan
Bildervortrag von Annika Schulze
Seit dem Jahre 1968 wählt die Stadt Hamburg mit Erlaubnis der Japan Cherry Blossom Association regelmäßig eine Kirschblütenprinzessin. Hamburg ist damit, neben Washington D.C. und Melbourne, eine von nur drei Städten weltweit, die dieses Amt zur Pflege der kulturdiplomatischen Beziehungen zu Japan vergeben dürfen.
Am 4. Mai 2011 wird die aktuelle Kirschblütenprinzessin Annika Schulze an der Universität Hamburg einen Vortrag über ihre Amtsantrittreise nach Japan im Jahre 2010 halten. Annika Schulze bekleidet das Amt seit Mai 2009. Sie studierte Architektur und Städtebau in Weimar, Hamburg und Tôkyô.
In ihrem Vortrag wird Frau Schulze anhand persönlicher Kenntnisse und Erfahrungen in Japan Einblicke in ihre Aktivitäten als Kirschblütenprinzessin geben und über die Bedeutung dieses Amtes informieren. Im Anschluss an den Vortrag gibt es für interessierte Gäste und potentielle Bewerberinnen die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Gespräch. Anlaß der Veranstaltung ist zugleich die bevorstehende Wahl der 27. Kirschblütenprinzessin Hamburgs am 21. Mai 2011. Angesichts des diesjährigen 150. Jubiläums des Freundschaftsvertrags zwischen Japan und Deutschland (Preußen), aber auch angesichts der schweren Folgen des Erdbebens in Japan vom 11. März, erwartet die zukünftige Kirschblütenprinzessin eine besonders verantwortungsvolle, jedoch auch schöne Aufgabe.
12. - 14. April 2011
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Auftaktveranstaltung der Japan-Wochen an deutschen Hochschulen
Internationales Symposium
Wissen schaffen, Wissen nutzen - Perspektiven aus Japan und Deutschland
Veranstaltungen 2010
15. Dezember 2010 (10.15 - 13.45 Uhr)
Ort: Gästehaus der Universität Hamburg - Internationales Begegnungszentrum
Rothenbaumchaussee 34, 20148 Hamburg
Symposium: Interkulturelle Kompetenz in Pflegeberufen: Zukunftsperspektiven im internationalen Vergleich
Dienstag, 30. November 2010, 20 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Gastvorlesung in japanischer Sprache (J/D gedolmetscht)
Über Budô
Prof. Kurosu Ken (Universität Tohoku Gakuin)
Ähnlich dem Begriff der „Ritterlichkeit“, dem mos nobilium, im europäischen Mittelalter, nimmt budô als „Weg des Kriegers“ im traditionellen japanischen Denken eine wichtige Rolle ein. Der Vortrag wird die historische Entwicklung des budô und seine wichtigsten Elemente nachvollziehen und erläutern.
武道の特徴は,稽古,型,習,学,などの言葉で表すことが出来る。稽古とはいにしえ を考えることであり,その具体的内容は「型」を学び習う事である。「型」は技術だけ ではなく,師匠の考え方や生き方までも含まれる。稽古とは先人達の行いを追体験(正 確にスキャンしてしてコピー)することによって,その到達した境地に至ろうとする事 である。道とは稽古の実践(行)を意味し修行は日常生活の中で行われる。
Kurosu Ken ist Professor für die Geschichte des Budô an der Universität Tohoku Gakuin in Sendai. Er lehrt darüber hinaus Kyudô, die Kunst des japanischen Bogenschießens.
Freitag, 12. November 2010, 14:15 bis 20:30 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Studierenden-Workshop
Zuwanderung nach Japan Rechtliche Rahmenbedingungen, politischer Diskurs und sozioökonomische Integration mit anschließender Vorführung des Dokumentarfilms "Sour Strawberries - Japan's hidden guestworkers"
Donnerstag, 28. Oktober 2010, 18 bis 20 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Gastvortrag in englischer Sprache
Intersecting Risks and Governing Okinawa: American Bases and the Unfinished War
Glenn D. Hook (The University of Sheffield)
This talk investigates the internal risks posed by US military installations to the inhabitants of Okinawa as a result of the security policy adopted by the government to deal with the external risks and specific threats faced by Japan. Although these outposts of US power are viewed by supporters of the alliance as beneficial to the security of Japan, their existence and operation pose risks to the population, with the overwhelming burden imposed on the inhabitants of Okinawa, whether in terms of crimes, noise and environmental pollution, or the erosion of solidarity amongst the population due to the divisive role foreign bases play. The presentation thus does not focus on the external risks posed to Japan by the hypothetical enemy of the day, as with the Soviet Union during the Cold War or North Korea today, but rather on the internal risks to the everyday lives and peace of Okinawans posed by the American presence. A key concern is how the risks of the bases are articulated by the inhabitants and mediated by the state as part of the national governing system of Japan. This system of governance distributes, allocates and locates the bases unequally, exposing Okinawa to disproportionate dangers and hazards, but offers compensation as a way to deal with the problems their existence and operation pose.
Glenn D. Hook is Toshiba International Foundation Anniversary Research Professor in Japanese Politics and International Relations and Director of the Graduate School of East Asian Studies, the University of Sheffield, UK. He is also the Director of the National Institute of Japanese Studies (NIJS), an international Centre of Excellence with the University of Leeds funded by the British authorities. His research interests are in Japanese politics, international relations and security, particularly in relation to East Asia. His recent work includes Japanese Responses to Globalization (coeditor, Palgrave, 2006); Japan's International Relations: politics, economics and security (coauthor, Routledge, 2005 (second edition); and Contested Governance in Japan: sites and issues (editor, 2005, RoutledgeCurzon).
19. Juli 2010, 17-18:30 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 120
Gastvortrag
Inbound M&A to Japan? Cherry Picking versus Rescue Mission?
Prof. Dr. Ralf Bebenroth, Kobe Universität
1. Juli 2010: Preis für Nachwuchswissenschaftlerin der Abteilung
Wir freuen uns, daß Gabriela Kruza den Preis Gleichstellungsförderfonds der Fakultät für Geisteswissenschaften für die beste Magisterarbeit 2009 zu einem genderspezifischen Thema verliehen bekommen hat. Sie erhält den Preis für ihre Arbeit mit dem Titel "Onnarashii hanashikata - Diskurse über Weiblichkeit und Sprache im modernen Japan". Darin untersucht sie das Phänomen der japanischen Frauensprache, d.h. geschlechtsspezifischer Merkmale im Japanischen, die ausschließlich oder bevorzugt von Frauen gebraucht werden. Im Fokus steht dabei aktuelle japanische Ratgeberliteratur, die es sich zum Ziel setzt, Frauen zum Gebrauch der betreffenden Merkmale zu animieren. Anhand einer Analyse dieser Diskurse kann die Autorin zeigen, inwiefern es sich bei dem Attribut "Weiblichkeit" in der japanischen Sprache um ein gesellschaftliches Konstrukt handelt.
Samstag, 12. Juni 2010, 13 bis 18:30 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
2. BSI Bundesweiter Japanisch-Redewettbewerb
Montag, 7. Juni 2010, 18 bis 20 Uhr
Ort: Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ost, 20146 Hamburg, Raum 221
Gastvortrag in englischer Sprache
Long Term Care in Japan's Aging Society
John C. Campbell (Tokyo University)
 How to take care of frail older people is a crucial issue in all advanced nations. The Japanese version of Pflegeversicherung, Kaigo Hoken, celebrates its 10th birthday this year. Unlike the German program, which seeks to support family caregiving through cash payments, Japan tries to relieve family members by providing formal services only. This presentation will introduce these crucially different designs of Pflegeversicherung and Kaigo Hoken, and examine the policymaking processes that lead to this outcome.
How to take care of frail older people is a crucial issue in all advanced nations. The Japanese version of Pflegeversicherung, Kaigo Hoken, celebrates its 10th birthday this year. Unlike the German program, which seeks to support family caregiving through cash payments, Japan tries to relieve family members by providing formal services only. This presentation will introduce these crucially different designs of Pflegeversicherung and Kaigo Hoken, and examine the policymaking processes that lead to this outcome.
John Creighton Campbell is Professor Emeritus of Political Science at the University of Michigan and Visiting Professor in the Institute of Gerontology at Tokyo University. He is the author of Contemporary Japanese Budget Politics, How Policies Change: The Japanese Government and the Aging Society, and (with Naoki Ikegami) The Art of Balance in Health Policy: Maintaining Japan's Low-Cost, Egalitarian System (all also available in Japanese).
Dienstag, 23. März 2010, 19 bis 21 Uhr
Ort: Internationales Begegnungszentrum / Gästehaus der Universität
Rothenbaumchaussee 34, D-20148 Hamburg
Vortrag mit Podiumsgespräch
Aktuelle Literaturtrends in Japan seit der J-BUNGAKU-Strömung in den 90iger Jahren
SASAKI Atsushi, ein namhafter japanischer Literaturkritiker, wird in diesem Vortrag die wichtigsten Tendenzen der jungen Literaturszene in Japan vorstellen, insbesondere die Situation der jungen Generation und ihren Widerhall in der Kreativszene insgesamt, vor allem im Bereich von Musik und Bühnenkunst. Dazu gibt er einen Überblick über das Phänomen der sog. „J-Bungaku“, eine Kategorisierung, die analog zum „J-Pop“ die Literatur der 90iger Jahre und ihre zahlreichen Schnittstellen zu anderen Kunstgattungen wie Pop-Musik, Film, Fotografie und Theater benennt. Vorgestellt werden die wichtigsten Akteure im Literaturbetrieb der Post-Murakami-Ära wie beispielsweise die Autoren TAWADA Yôko, ABE Kazushige und HOSAKA Kazushi in den 90iger Jahren und MAIJÔ Ôtarô und FURUKAWA Hideo in der zurückliegenden Dekade.
Im nachfolgendem Dialog mit den Hamburger Japanologen Gabriele Vogt und Jörg Quenzer sollen einerseits die derzeit vorherrschenden Kunstströmungen unter dem Einfluss von Globalisierung und neuer digitaler Medien und andererseits soziale Probleme der Gegenwart, wie die Wirtschaftskrise und ihre Folgen für den Arbeitsmarkt junger Menschen, thematisiert werden.
SASAKI Atsushi ist in Japan als prominenter Kritiker und Leiter des Post-Technokollektivs „Headz“ mit eigenem Label bekannt. Er ist zudem Herausgeber des Magazins „Fader“ und Inhaber einer Konzert-Agentur. An den Keiô-Universität lehrte er von 2001 bis 2006 über Pop-Media, seit 2007 an der Universität Waseda Musik, Musikgeschichte und Kulturtheorie. Er veröffentlichte mehrere Bücher, die sich inhaltlich mit der aktuellen Kulturszene Japans und ihren philosophischen und gesellschaftlichen Hintergründen befassen.
Veranstaltungen 2009
26. Oktober 2009:
Symposion zum 20-jährigen Städte- und Universitätspartnerschaftsjubiläum Ôsaka–Hamburg
Mai 2009:
Frau Prof. Dr. Gabriele Vogt nimmt ihre Lehrtätigkeit in der Nachfolge von Prof. Dr. Pohl auf.
Veranstaltungen 2008
Mai 2008:
Eine große Gruppe von Studierenden nahm an einer Seminarexkursion zur Daigoji-Ausstellung ("Tempelschätze des heiligen Berges") in der Bundeskunsthalle Bonn teil (30./31. 5. 2008).
Februar 2008:
Die Japanologie hat als Teil der Forschergruppe "Manuskriptkulturen in Asien und Afrika" ein Teilprojekt durch die DFG genehmigt bekommen.
